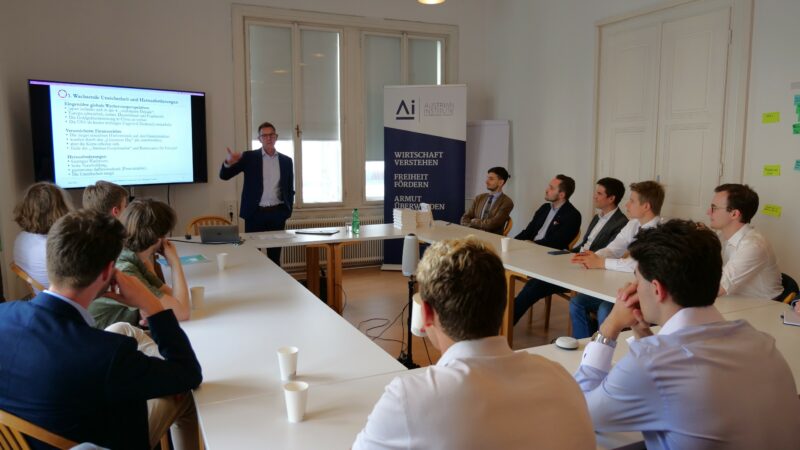Sozialwohnungen, ehemals Arbeiterwohnungen, in Berlin. Mit Steuergeldern subventionierte Sozialwohnungen sind das Aushängeschild des modernen Sozialstaates. Sie sind auch typisch für sein Versagen. Weil es die Marktkräfte ausschaltet, verknappt das Eingreifen des Staates schlussendlich das Angebot an erschwinglichem Wohnraum. (Bild: Wikimedia Commons)
Sozialwohnungen, ehemals Arbeiterwohnungen, in Berlin. Mit Steuergeldern subventionierte Sozialwohnungen sind das Aushängeschild des modernen Sozialstaates. Sie sind auch typisch für sein Versagen. Weil es die Marktkräfte ausschaltet, verknappt das Eingreifen des Staates schlussendlich das Angebot an erschwinglichem Wohnraum. (Bild: Wikimedia Commons) Während viel von den gewaltigen Ausgaben für Klimapolitik, Energiewende, „Zukunftsinvestitionen“ und eine kriegstaugliche Bundeswehr gesprochen wird und man dafür Schulden über Schulden anzuhäufen gewillt ist, so dass sogar das Bundesverfassungsgericht bremsend einschreiten musste, wird der Elefant im Raum kaum erwähnt: das enorme Summen verschlingende Sozialsystem. Es frisst finanzielle Mittel auf, die der Staat für andere, ja für seine ureigensten Aufgaben dringend bräuchte: Sicherheit, Verteidigung, Infrastruktur.
Für Ludwig Erhard war das Soziale an der „sozialen Marktwirtschaft“ – er schrieb sie mit kleinem s – der Wettbewerb. So würde ein jeder den Platz in der Gesellschaft einnehmen, der ihm aufgrund seiner Leistungsfähigkeit und effektiven Leistung zukommt. Vor allem dies sollte das Adjektiv „sozial“ zum Ausdruck bringen.
Hohe Fiskalquote und öffentliche Verschuldung bilden eine strukturelle Barriere, es bleiben kaum mehr Spielräume. Dank enorm hoher Steuerlast schwimmt der Fiskus zwar im Geld, doch belaufen sich allein die erbrachten Sozialleistungen in Deutschland während der letzten zwanzig Jahre auf jeweils etwa 30 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung (BIP). Die Sozialausgaben des Bundes belaufen sich 2024 auf den Rekordwert von 54,3% der Gesamtausgaben (2013: 47%). Fehlende Mittel für vernachlässigte Aufgaben verschafft man sich nun mit kreditfinanzierten „Sondervermögen“ – sprich: höherer Verschuldung. Unvermeidlich ergibt sich daraus eine Schuldenquote, die ständig wächst.
Letztlich schuldenfinanzierter Sozialstaat
Die USA sind heute in Prozentanteilen am BIP höher verschuldet als unmittelbar nach Ende des Zweiten Weltkriegs – eine Schuldenlast, die nicht wie Kriegsschulden einfach abgebaut werden kann! Diese strukturelle Überschuldung ist beunruhigend, wenn man bedenkt, welche gewaltigen Ausgaben nicht zuletzt im Sicherheits- und Verteidigungsbereich anstehen. Auch in den USA existieren Sozialprogramme wie Medicaid und Medicare wie auch ein System der Sozialversicherung, die Unsummen verschlingen – Tendenz steigend. Diese finanziellen Verpflichtungen, allen voran die Pensionsansprüche, sind sogenannte implizite Staatsschulden. Diese werden nicht in den offiziellen Schuldenstatistiken ausgewiesen, sind aber dennoch Verbindlichkeiten des Staates gegenüber seinen Bürgern. In Deutschland belaufen sie sich nach Schätzungen auf weit über 400% des BIP.
Um den fetten Sozialstaat am Leben zu halten, finanziert sich damit die öffentliche Hand auf Kosten der zukünftigen Generationen, die die Zeche mit noch höheren Steuern, dem Verfall der Kaufkraft ihrer Währung und deshalb mit dramatischen Wohlstandsverlusten werden begleichen müssen. Wie nur ist es dazu gekommen?
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde in Deutschland mit Ludwig Erhard als Wirtschaftsminister eine auf der Marktwirtschaft basierende Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung eingeführt, und zwar mit dem Versprechen, Marktwirtschaft bzw. marktwirtschaftlicher Wettbewerb seien schon als solche sozial.
Das Fatale große S: Erhard kontra Müller-Armack
Denn für Ludwig Erhard war das Soziale an der „sozialen Marktwirtschaft“ – er schrieb sie mit kleinem s – der marktwirtschaftliche Wettbewerb. So würde ein jeder den Platz in der Gesellschaft einnehmen, der ihm aufgrund seiner Leistungsfähigkeit und effektiven Leistung zukommt. Vor allem dies sollte das Adjektiv „sozial“ zum Ausdruck bringen. So schrieb Erhard 1957, „Wohlstand für alle“ und „Wohlstand durch Wettbewerb“ gehörten untrennbar zusammen. Niemand dürfe die Freiheit haben, die Freiheit anderer durch eine wirtschaftliche Machtstellung zu unterdrücken.
„Sozial“ ist eine Marktwirtschaft, wenn sie den „wirtschaftlichen Fortschritt, die höhere Leistungsergiebigkeit und die steigende Produktivität dem Verbraucher schlechthin zugutekommen lässt“. Die Feinde von Wettbewerb und Wohlstand waren für den Vater des deutschen „Wirtschaftswunders“ Monopole und Kartelle.
„Sozial“ ist eine Marktwirtschaft, wenn sie den „wirtschaftlichen Fortschritt, die höhere Leistungsergiebigkeit und die steigende Produktivität dem Verbraucher schlechthin zugutekommen lässt“. Die Feinde von Wettbewerb und Wohlstand waren für den Vater des deutschen „Wirtschaftswunders“ Monopole und Kartelle. Diese seien durch staatliche Wettbewerbspolitik in die Schranken zu weisen und, wenn nötig, zu zerschlagen.
Aufgrund der Erfahrungen vor dem Ersten Weltkrieg und der Weimarer Republik mit ihren mächtigen Syndikaten, Kartellen und Monopolen erschien damals vielen – so auch Erhard – der alte Liberalismus des ungeregelten freien Marktes diskreditiert. Dies, obwohl Erhards engster Mitarbeiter Alfred Müller-Armack 1946 geschrieben hatte, „die Hauptursachen des Versagens der liberalen Marktwirtschaft“ würden „nicht so sehr in ihr selbst liegen, als in einer Verzerrung, der sie durch den von außen kommenden Interventionismus seit dem Ende des vergangenen Jahrhunderts zunehmend unterlag“.
Erhard, die Ordoliberalen und der Schatten der Kathedersozialisten
Erhards Fokussierung auf die Bekämpfung von Monopolen und Kartellen – ein Vermächtnis seines Lehrers Franz Oppenheimer – wurde zwar auch von Ordoliberalen wie Walter Eucken oder Alexander Rüstow geteilt. Wie Müller-Armack erkannten sie jedoch, dass schädliche Monopole und Kartelle nicht Ergebnis des freien Marktes, sondern immer Folge des staatlichen Interventionismus und von Schutzzöllen waren. Die Gründe für diesen Interventionismus waren in Deutschland machtpolitischer und vor allem sozialpolitischer Natur gewesen. So meinte 1905 der sozialpolitisch damals tonangebende Wirtschaftsprofessor Gustav Schmoller, die Deutschen sollten auf ihre Kartelle „stolz sein“, denn in ihnen zeige sich der „Sieg gewisser gemeinsamer Interessen über Eigensinn und kurzsichtigen Egoismus“…
Von diesem, wie man es damals nannte, „kathedersozalistischen“ Denken vielleicht beeinflusst, begann dann just Müller-Armack „Soziale Marktwirtschaft“ mit großem „S“ zu schreiben. Dieses S wurde im Laufe der Zeit immer größer. 1956 schon erklärte Müller-Armack, der „Gedanke der Sozialen Marktwirtschaft“ beschränke sich nicht darauf, „das Instrumentarium der Konkurrenz sozial funktionsfähig zu machen“. Vielmehr biete der „wirtschaftliche Einkommensprozess“ […] der Sozialpolitik ein tragfähiges Fundament für eine staatliche Einkommensumleitung, die in Form von Fürsorgeleistungen, Renten- und Lastenausgleichszahlungen, Wohnbauzuschüssen, Subventionen usw. die Einkommensverteilung korrigiert“.
Anstelle der Idee einer sozialen Absicherung für Härtefälle wurde aus der „Sozialen Marktwirtschaft“ mit dem großgeschriebenem „S“ ein sozialstaatlicher Verteilungsapparat, der allen Bürgern einen nach Maßstäben der Wohlstandsgesellschaft menschenwürdigen Lebensunterhalt garantieren soll.
Man liest das mit Erstaunen, beklagte doch der nüchterne Erhard in seinem Buch „Wohlstand für alle“ von 1957 die „wachsende Sozialisierung der Einkommensverwendung, die um sich greifende Kollektivierung der Lebensplanung die weitgehende Entmündigung des einzelnen und die zunehmende Abhängigkeit vom Kollektiv oder vom Staat“. Er warnte vor der Entstehung des „sozialen Untertans“ durch eine umverteilende Sozialpolitik, dem „übermächtigen Ruf nach kollektiver Sicherheit“ und damit verbundener „Flucht vor der Eigenverantwortung“, die zu einer gesellschaftlichen Ordnung führt, „in der jeder die Hand in der Tasche des anderen hat“.
Sozialstaatlicher Verteilungsapparat und vernachlässigte Staatsaufgaben
Erhard kritisierte damit keineswegs die historisch gewachsene Sozialversicherung – diese verteidigte er explizit –, und auch nicht einen sozialen Ausgleich für Härtefälle, wohl aber die Tendenz zum Versorgungsstaat und die damit einhergehende „Aufblähung der öffentlichen Haushalte“. Und damit sind wir beim Thema: Was geschehen sollte, war nicht im Sinne von Erhards sozialer Marktwirtschaft. Nicht in seinem Sinne waren diese Aufblähung der öffentlichen Haushalte infolge eines immer größer werdenden S und damit die ständig ansteigende produktivitäts- und damit wohlstandsmindernde Steuerbelastung der Bürger. Ebenso wenig war es die präzedenzlose öffentliche Verschuldung, weil der Sozialstaat für die eigentlichen Staatsaufgaben und entsprechende unumgängliche Ausgaben keine genügenden fiskalischen Spielräume übrig ließ.
Anstelle der Idee einer sozialen Absicherung für Härtefälle wurde aus der „Sozialen Marktwirtschaft“ mit dem großgeschriebenem „S“ ein sozialstaatlicher Verteilungsapparat, der allen Bürgern einen nach Maßstäben der Wohlstandsgesellschaft menschenwürdigen Lebensunterhalt garantieren soll.
Natürlich lässt eine anständige Gesellschaft niemanden auf der Straße liegen. Der Staat kann aber nicht dafür zuständig sein, durch materielle Leistungen allen ein von ihm immer wieder neu definiertes Maß an Menschenwürde zu garantieren und dabei den Kreis der Anspruchsberechtigten ständig auszuweiten.
„Relative Armut“ – wie man Armut konstant hält
Doch genau so geschah es. Der moderne Sozialstaat hat es geschafft, trotz des beständig steigenden allgemeinen Wohlstands Armut und Hilfsbedürftigkeit konstant zu halten. Dies durch eine Neudefinition der Armut: Nicht, ob jemand tatsächlich arm ist, zählt, nicht also, ob er sich kein Dach über dem Kopf leisten, sich nicht ernähren oder auch nicht arbeiten kann. Das wäre nur „absolute Armut“. Man führte international den Begriff der „relativen Armut“ ein, deren Niveau in Bezug auf das Medianeinkommen gemessen wird, so dass mit ansteigendem allgemeinem Lebensstandard und damit ebenfalls steigendem Medianeinkommen die Armutsschwelle automatisch mitansteigt. So bleibt dann, obwohl es allen immer besser geht, die Armutsquote mehr oder weniger konstant.
Ganz falsch ist das Konzept der „relativen Armut“ freilich nicht – aber nur so lange, als sich der allgemeine Wohlstand auf einem sehr tiefen Niveau befindet, so dass auch relative Armut immer noch bittere Armut ist. Doch das ist heutzutage keineswegs der Fall. Denn heute gilt ja als „relativ“ arm, wer eben schlicht und ergreifend nicht in bitterer Armut lebt, weil er an den Segnungen der modernen Konsumgesellschaft mit ihren für alle erschwinglichen Massenprodukten automatisch teilhat.
Wer, auch wenn er deshalb weniger „verdient“, nicht arbeitet, obwohl er arbeiten könnte, und dann mit dem immer großzügiger bemessenem Bürgergeld über Wasser gehalten wird, der lebt in ungerechter Weise auf Kosten seiner Mitbürger. Diese werden gezwungen, seine Hängemattenmentalität zu finanzieren.
Soll er trotzdem durch Sozialtransfers – mit seinen Mitbürgern weggesteuertem Geld also –, mit Bürgergeld, Wohngeld, Kindergeld und andere Arten der Umverteilung eine Einkommensaufbesserung erhalten, die gar den Anreiz, seine Situation durch eigene Arbeit zu verbessern, verringern? Wer, auch wenn er deshalb weniger „verdient“, nicht arbeitet, obwohl er arbeiten könnte, und dann mit dem immer großzügiger bemessenem Bürgergeld über Wasser gehalten wird, der lebt in ungerechter Weise auf Kosten seiner Mitbürger. Diese werden gezwungen, seine Hängemattenmentalität zu finanzieren.
Pervertierung der leistungsbasierten Einkommensverteilung durch das große „S“
Sagen wir es offen und ehrlich: Erhards Konzept einer leistungsbasierten Einkommensverteilung wurde durch das große „S“ zunehmend pervertiert. Gemäß Erhards Konzept gehörte auch soziale Ungleichheit wesentlich zu einer auf Selbstverantwortung und Leistung gründenden Gesellschaft. Diese entwickelt dann ihre eigenen, unbürokratischen Formen von Solidarität und Mitmenschlichkeit. Soziale Ungleichheit ist, als solche betrachtet, noch keine Ungerechtigkeit – ungerecht ist sie nur, wenn sie Folge von Ungerechtigkeit (z. B. Rassendiskriminierung oder andere Formen von diskriminierender Rechtsungleichheit) ist.
Wenn der Staat für die Gleichheit vor dem Gesetz sorgt und für ein Bildungssystem, von dem niemand ausgeschlossen ist, werden zwar immer noch nicht alle die gleichen Startchancen haben, wohl aber haben alle die Chance, mit der Zeit ihr Einkommen und ihre soziale Stellung zu verbessern. Ein höheres Maß an Gleichheit ist von der Politik vernünftigerweise nicht zu fordern. Eine systematische Einebnung sozialer Ungleichheit verlangt gravierende Eingriffe in Freiheit und Eigentum, ist ökonomisch schädlich und damit letztlich unsozial. Zudem erhält dadurch der Staat bzw. Politik und Bürokratie eine Macht, die brandgefährlich ist.
Denn Macht korrumpiert – zumindest tendenziell –, in diesem Fall allerdings mit einer Form der „Korruption“, die in unserer Gesellschaft als Ethos einer Beamtenschaft, die im Dienste des Bürgers öffentliche Gelder verteilt, geradezu eine Art Heiligenschein trägt. Wie jede Bürokratie versucht auch die Sozialbürokratie sich unentbehrlich zu machen und auszuweiten. Wie Ludwig von Mises im Jahre 1944 in seinem Klassiker „Die Bürokratie“ schrieb, arbeiten Bürokratien nicht wie Wirtschaftsunternehmen mit eigenem Geld und unter dem Zwang zur Rentabilität; da sie ausschließlich mit Steuergeldern „wirtschaften“, kann deshalb allein politische Kontrolle ihrem Verteilungseifer Einhalt gebieten.
Weil demokratisch gewählte Politiker stets ihre Wiederwahl im Auge haben und deshalb ihren Wählern gerne Geschenke in der Form von Sozialleistungen, verteilen, haben es letztlich allein die Bürger in der Hand, an der Wahlurne diesem Treiben ein Ende bereiten. Das nun langsam sich abzeichnende Erwachen aus vielen Illusionen wird allerdings erst für die nächsten Generationen so richtig weh tun. Das zeigt: Der Generationenvertrag funktioniert nicht mehr, es braucht neue Lösungen, die die Last sozialer Sicherung nicht in die Zukunft verschiebt, sondern jenen auferlegt, die heute davon profitieren.
Zerstörung des Generationenvertrags: Beispiel umlagefinanzierte Rentenversicherung
Wie der Generationenvertrag durch die innere Logik des Systems zerstört wurde, lässt sich an der umlagefinanzierten Rentenversicherung zeigen. Wie im Jahre 2005 ein Gutachten des wissenschaftlichen Beirates des (damaligen) „Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit“ (BMWA) mit dem Titel Alterung und Familienpolitik festhielt „verringert die Umlagerente zugleich die Anreize, selbst Kinder zur Welt zu bringen und aufzuziehen.“ Denn man erwirbt „einen Rentenanspruch schon dann, wenn man auf dem Wege der Beitragszahlung die Generation seiner Eltern finanziert. Dass man selbst Kinder hat, ist nicht wichtig. Ohne Kinder kollabiert jedoch das Umlagesystem“ (S. 41).
Präzis so ist es nun gekommen. Infolge der rückläufigen demographischen Entwicklung schrumpft auch die arbeitende Bevölkerung. So entsteht im umlagefinanzierten Rentensystem mit seinen reproduktionsfeindlichen Anreizen ein wachsendes Loch, das mit Steuergeldern bzw. Schulden gestopft werden muss. Der hellsichtige Erhard hatte sich noch gegen das Umlagesystem ausgesprochen, Konrad Adenauer hingegen wollte es, denn nur so konnte er sich seine Wiederwahl sichern. Das war der erste größere Sündenfall der „Sozialen Marktwirtschaft“.
Mit der Schaffung eines Systems, das nur noch über die Aufnahme immer neuer Schulden am Leben erhalten werden kann, zerstört die „Soziale Marktwirtschaft“ ihre eigenen Grundlagen. Grundlage eines funktionierenden Sozialstaates ist wirtschaftliche Wertschöpfung und Produktivitätssteigerung – Wirtschaftswachstum also –, eine wettbewerbliche Marktwirtschaft und eine stabile Währung.
Eine kaum tragbare Belastung für den Sozialstaat ist auch die unkontrollierte Zuwanderung von Menschen, die selbst nichts zur Finanzierung des Sozialstaats beitragen können. Erschwerend hinzu kommt die jahrzehntelange Phase niedriger Zinsen, die Schulden als unproblematisch erscheinen ließen. Warnungen wurden in den Wind geschlagen. Mit der durch die jahrelange Billiggeldschwemme hervorgerufenen Inflation – sie begann lange vor dem kriegsbedingten Anstieg der Energiekosten – und den in der Folge angestiegenen Zinsen bekommen wir nun die Rechnung serviert.
Mit der Schaffung eines Systems, das nur noch über die Aufnahme immer neuer Schulden am Leben erhalten werden kann, zerstört die „Soziale Marktwirtschaft“ ihre eigenen Grundlagen. Grundlage eines funktionierenden Sozialstaates ist wirtschaftliche Wertschöpfung und Produktivitätssteigerung – Wirtschaftswachstum also –, eine wettbewerbliche Marktwirtschaft und eine stabile Währung, mit anderen Worten: ein funktionierender Kapitalismus, dem nicht durch überhohe Besteuerung der produktiven Kräfte der Gesellschaft, durch staatlichen Interventionismus und bürokratische Regulierungen und zudem durch eine inflationäre Geldpolitik immer mehr die Flügel gestutzt werden.
„Zukunftsinvestitionen“ auf Pump statt wirtschaftliche Wertschöpfung
Dagegen lebt nun – im Gleichschritt mit der gesamten EU – ein Land wie Deutschland, das einst Vorbild unternehmerisch-industrieller Dynamik und Wachstumslokomotive Europas war, im Zeitalter von Industriepolitik, staatlichen „Zukunftsinvestitionen“, grüner Planwirtschaft und reichlich fließenden Subventionen für die Realisierung obrigkeitlich definierter Zielgrößen – alles zunehmend mit Schulden finanziert.
Dies ist keine kapitalistisch-marktwirtschaftliche Welt mehr, sondern, gemäß dem Ausdruck des Frankfurter Wirtschaftshistorikers Werner Plumpe, eine „transformative Verwaltungswirtschaft“. Wie alle Systeme, deren Ausgaben letztlich nicht durch wirtschaftliche Wertschöpfung gedeckt sind – wie der Sowjetsozialismus oder die DDR –, endet schließlich auch die wachstumsfeindliche „transformative Verwaltungswirtschaft“ in ihrer Selbstkannibalisierung.
Da nun infolge des aufgeblähten Sozialstaates für zentrale staatliche Aufgaben wie Sicherheit, Verteidigung und Infrastruktur die notwendigen fiskalischen Spielräume fehlen, wird sich – findet keine drastische Schubumkehr statt – die Tendenz zur Selbstkannibalisierung des Systems unvermeidlich akzentuieren. Eine notwendige Kehrtwende wäre schmerzhaft und ist bislang nicht in Sicht, politisch ist sie zurzeit weder gewollt noch vorstellbar. Der unausweichliche Zwang dazu wird aber einmal kommen, und zwar so, wie in der Geschichte alles Unausweichliche, beugt man ihm nicht rechtzeitig vor, unweigerlich einmal kommt: auf eher dramatische und gerade für die sozial Schwächsten härteste Weise. In welcher Form und wann, das kann niemand im Voraus wissen.
Dieser Artikel ist zunächst unter dem Titel „Die Soziale Marktwirtschaft zerstört ihre eigenen Grundlagen“ am 20. März 2024 auf Cicero online erschienen.
Teilen auf
- Altersvorsorge
- Arbeit
- Arbeitslosenversicherung
- Arbeitsmarkt
- Armut
- Blog
- Bürokratie
- Demographie
- Featured Content
- Gerechtigkeit
- Gesellschaft
- Kartelle
- Martin Rhonheimer
- Menschenwürde
- Monopole
- Ordoliberalismus
- Pensionen und Renten
- Produktivität
- Schulden
- Soziale Gerechtigkeit
- Soziale Marktwirtschaft
- Sozialpolitik
- Sozialstaat
- Staat und Politik
- Staatsschulden
- Umverteilung
- Ungleichheit
- Verteidigungspolitik
- Wachstum und Wachstumspolitik
- Wettbewerb
- Wohlstand