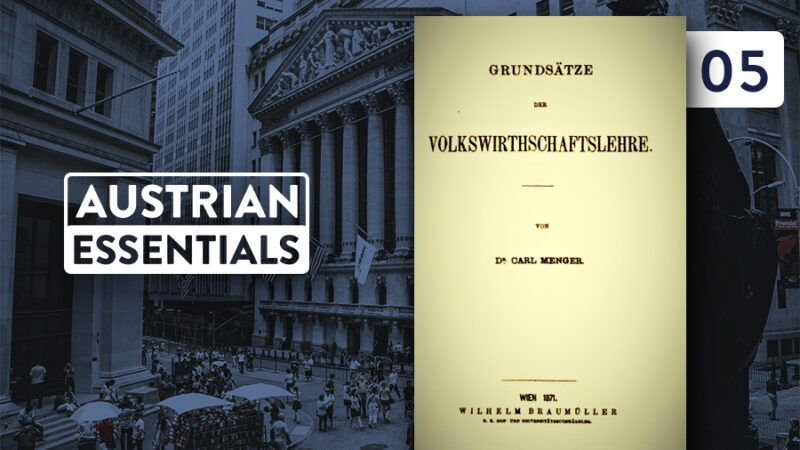Die Expertenrunde in der Politischen Akademie der ÖVP vom 27. Dezember 2020: Moderator Rudolf Mitlöhner (zweiter von links) disktuiert mit (von links) Matthias Beck von der Universität Wien, Bettina Rausch, Präsidentin der Politischen Akademie der Volkspartei und Emmanuel J. Bauer, Universität Salzburg. Ingeborg Gabriel, Universität Wien, ist per Video-Konferenz dazugeschaltet. (Bild: Screenshot YouTube)
Die Expertenrunde in der Politischen Akademie der ÖVP vom 27. Dezember 2020: Moderator Rudolf Mitlöhner (zweiter von links) disktuiert mit (von links) Matthias Beck von der Universität Wien, Bettina Rausch, Präsidentin der Politischen Akademie der Volkspartei und Emmanuel J. Bauer, Universität Salzburg. Ingeborg Gabriel, Universität Wien, ist per Video-Konferenz dazugeschaltet. (Bild: Screenshot YouTube) In einer Meldung der Katholischen Presseagentur Österreich KATHPRESS vom 30. Dezember 2020 war zu lesen:
„Sozialethikerin Ingeborg Gabriel distanzierte sich von der Position des Schweizer Priesters und Professors für Ethik und politische Philosophie, Martin Rhonheimer, der sowohl christlich als auch sozial für politisch nicht relevante Kategorien halte. Zu sagen, Sozialpolitik sei eigentlich unnötig, weil sie die freien, sich selbst regulierenden Kräfte des Marktes behindern, würde die Grundlagen einer auf Frieden und Gerechtigkeit basierenden Demokratie zerstören, so Gabriel.“
Die Meldung bezog sich auf eine „Expertenrunde“, die die Politische Akademie der Volkspartei am 27. Dezember 2020 zur Vorstellung des von ihr herausgegebenen Buches „Christlich-soziale Signaturen“ durchführte. In diesem Band findet sich auch ein Beitrag des Präsidenten des Austrian Institute, Martin Rhonheimer, mit dem Titel „Politik für den Menschen braucht weder ‚christlich‘ noch ‚sozial‘ zu sein“. Der Beitrag wurde vorab auch als Austrian Institute Paper publiziert und kann hier in der Buchfassung heruntergeladen werden.
In der „Expertenrunde“, die auf der Website der Politischen Akademie der ÖVP bzw. auf YouTube in der ganzen Länge nachverfolgt werden kann, warf Ingeborg Gabriel (emeritierte Lehrstuhlinhaberin für Sozialethik am Institut für Systematische Theologie und Ethik der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Wien) Martin Rhonheimer unter anderem Folgendes vor:
- er halte Sozialpolitik für „kontraproduktiv“;
- seiner Ansicht nach seien „Recht“ und „Gerechtigkeit“, im Anschluss an F. A. Hayek, „eigentlich unsinnige Kategorien“;
- er würde die „normative Ebene völlig ausklammern“;
- er lehne staatliche bzw. rechtliche Regeln aller Art für den Markt ab;
- seine wirtschafts- und sozialethische Position sei mit der katholischen Soziallehre unvereinbar.
Ingeborg Gabriels Darstellung der Ansichten von Martin Rhonheimer ist unrichtig, sie beruht auf Unkenntnis und Fehlinterpretationen. Da er jedoch selbst zu der „Expertenrunde“ nicht eingeladen wurde, blieb nur die Möglichkeit einer nachträglichen Klarstellung. Eine solche findet sich in seinem ausführlich auf die Vorwürfe eingehenden Offenen Brief an Frau Gabriel, in dem auch auf Publikationen verwiesen wird, die er ihr im Anschluss an ihre erste Begegnung im Jahre 2016 zuschickte und eine ganz andere Sprache sprechen.
Der Offene Brief von Martin Rhonheimer an Ingeborg Gabriel kann hier heruntergeladen werden:
Nachfolgend findet sich eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Punkte, die in dem Brief klargestellt werden.

Martin Rhonheimer:
Zusammenfassung meiner Antwort auf die wichtigsten Vorwürfe und Fehlinterpretationen von Ingeborg Gabriel
Wie ich Frau Kollegin Gabriel in meinem Brief vom 12. 1. 2021 schrieb, hege ich die Befürchtung, ihre zum Teil persönlichen Angriffe und ihre offensichtlich falsche, letztlich auf Unkenntnis beruhende Darstellung meiner Position könnten zu einer Schädigung meines akademischen und innerkirchlichen Rufes führen. Aufgrund der Öffentlichkeit ihrer Anschuldigungen sah ich mich deshalb veranlasst, ihr ebenso öffentlich zu antworten. Dabei bemühe ich mich um eine sachliche und dokumentierte Argumentation, ohne Polemik, mit der Absicht, dass diese wichtige Auseinandersetzung mit allen Beteiligten auf faire Weise fortgeführt werden kann.
Hier in Kürze meine Klarstellungen zu den wichtigsten Punkten, auf die ich in meinem 16-seitigen Brief eingehe:
- Zum Vorwurf, ich halte Sozialpolitik für „kontraproduktiv“: Ich vertrete, wie in meinem Buchbeitrag deutlich wird, in Wirklichkeit die Meinung, Sozialpolitik bedürfe „einer soliden und ökonomisch nüchternen wirtschaftspolitischen Fundierung“. Für kontraproduktiv halte ich eine Sozialpolitik, die falsche Anreize setzt, Menschen dauerhaft in die Abhängigkeit vom Staat bringt und den wohlstandschaffenden Prozess der wirtschaftlichen Wertschöpfung durch falsche Anreize behindert, statt ihn zu fördern.
- Zum Vorwurf, „Recht“ und „Gerechtigkeit“ seien für mich – im Anschluss an F. A. Hayek –„eigentlich unsinnige Kategorien“ und ich würde die normative Ebene ausklammern: Hier werfe ich Frau Gabriel Unkenntnis sowohl der Ansichten Hayeks wie auch der meinen vor. Denn Hayeks Verdikt „unsinnige Kategorie“ bezieht sich allein auf den Begriff der „sozialen Gerechtigkeit“. Ich selbst teile Hayeks Verdikt nur teilweise, weil ich auch einen sinnvollen Begriff von „sozialer Gerechtigkeit“ als die Gerechtigkeit der sich auf das soziale Ganze beziehenden fundamentalen Rechtsordnung und der Regeln, in die die Marktwirtschaft eingebettet ist, anerkenne, diesen Begriff von sozialer Gerechtigkeit aber scharf von einer „Verteilungsgerechtigkeit“ unterscheide, als welche „soziale Gerechtigkeit“ heute in der Regel verstanden wird. So bezeichne ich, wie ich aus einem Artikel von mir in der „Neuen Zürcher Zeitung“ von 2016 zitiere, die heute verbreitete Sprache der „sozialen Gerechtigkeit“ als „die Sprache der normativen Willkür“. Denn für „soziale Gerechtigkeit im Sinne von Verteilungsgerechtigkeit gibt es bis heute keinerlei interessenunabhängige und ideologiefreie Kriterien“. Dagegen betone ich in dem Artikel: „Politisches und staatliches Handeln muss sich aufgrund von Regeln der Gerechtigkeit vollziehen.“ Davon, ich würde die normative Ebene ausklammern, kann also keine Rede sein.
- Zum Vorwurf, meiner Ansicht nach würde der Markt alles von allein regeln, staatliche Regelungen brauche es nicht: Dieser Vorwurf beruht auf der Missachtung der durchaus geläufigen Unterscheidung zwischen Regeln, die dem Markt einen rechtlichen Ordnungsrahmen verleihen, und, zweitens, Regeln, mit denen der Staat in die durch den Preismechanismus bestimmten Abläufe des Marktgeschehens selbst eingreift, um dessen Ergebnisse in eine bestimmte Richtung zu lenken, zu „korrigieren“ oder aber um gewisse gesellschaftliche Gruppen oder Industrien zu schützen, zu bevorteilen usw. Die erste Art von Regulierung halte ich – im Sinne Hayeks, aber auch der ordoliberalen Freiburger Schule – für wichtig und grundlegend, die zweite hingegen für prinzipiell schädlich, und zwar insofern sie den Wettbewerb verzerrt und die Allokationsfunktion des Marktes behindert, was – so sah es Ludwig Erhard – im Ergebnis unsozial ist. Frau Gabriels Kritik beruht also auf einem Mangel an Differenzierung, aus der sich eine Einseitigkeit ergibt, die offenbar nur zwei Extrempositionen kennt: „Regeln ja“ oder „Regeln nein“.
- Zum Vorwurf, meine Position sei mit der katholischen Soziallehre unvereinbar: Frau Gabriels Ansicht, der Markt könne „nicht soziale Ziele befriedigen“, widerspreche ich mit Hinweis auf die Enzyklika „Centesimus annus“ von Johannes Paul II. Der Sozialstaat als Transfersystem, das Menschen in dauerhafte Abhängigkeit vom Staat bringt, wurde, wie ich zeige, von Johannes Paul II., Benedikt XVI. und den deutschen Bischöfen kritisiert. Gegenüber der Tendenz, im Namen der „sozialen Gerechtigkeit“ soziale Aufgaben grundsätzlich dem Staat zu übertragen, verteidige ich an dieser Stelle das Subsidiaritätsprinzip und die für die katholische Soziallehre entscheidenden Funktionen der Familie, der Zivilgesellschaft, des Vereinswesens und des ehrenamtlichen sozialen Engagements sowie die christliche Verantwortung für Solidarität und Geschwisterlichkeit – das zentrale Anliegen von Papst Franziskus –, die, so hat es die katholische Soziallehre immer gesehen, nicht einfach an den Staat zu delegieren ist.
- Zu meinem Selbstverständnis als Ethiker und politischer Philosoph: Als in Ethik und politischer Philosophie spezialisierter Moralphilosoph bemühe ich mich um eine „ökonomisch und wirtschaftshistorisch aufgeklärte“ Argumentationsweise, wobei ich hingegen in der „Expertenrunde“ von Frau Gabriel – mit Verweis auf die Aussage eines von ihr nicht namentlich genannten Gewährsmanns – fälschlich als in seiner Zunft unbekannter Ökonom tituliert wurde, auf den man nicht zu antworten brauche. Ferner gehe ich auch auf mein Verhältnis zur katholischen Soziallehre ein, deren große Bandbreite konkreter Ausgestaltungen und Anwendungen niemand durch die Dogmatisierung des eigenen Verständnisses solcher Ausgestaltung einschränken und andere Positionen damit als unchristlich oder als „mit der katholischen Soziallehre unvereinbar“ ausgrenzen dürfe.
- Zu meiner Forderung, eine „Politik für den Menschen“ müsse weder „christlich“ noch „sozial“, sondern vielmehr „sachgerecht“ sein: Ich weise darauf hin, wie im zweiten Teil der „Expertenrunde“, in welcher vom Moderator nach konkreten politischen Anwendungen des „Christlichen“ und „Sozialen“ gefragt wurde, erstaunlicherweise plötzlich alle Diskutanten dafür plädierten, in der konkreten Politik müsse man sachgemäß argumentieren, aus christlichen Werten könne man direkt keine konkreten Lösungen ableiten – eine für mich überraschende Bestätigung meiner im Titel meines Buchbeitrages ausgedrückten, zu Beginn der „Expertenrunde“ aber von allen kritisierten These, die, so Frau Gabriel, ein „anarchisches Potenzial“ habe. Unter „konkreten Anwendungen“ äußerte sich Frau Gabriel zum Thema „Vermögenssteuer“, für die sie ebenfalls „nicht unbedingt eine christliche Argumentation bemühen“ wolle; dabei manifestierte sie aber ein Verständnis von Politik, das erstaunlicherweise den Gesichtspunkt der Gerechtigkeit und eine entsprechende normative Orientierung völlig ausklammerte.
*
In seinem Schlussvotum an der „Expertenrunde“ mahnte Diskussionsteilnehmer Matthias Beck von der Universität Wien eine christliche Gesprächskultur im Sinne einer „Hermeneutik des Wohlwollens“ an, die sich im Eröffnen von Räumen der Wahrheitssuche und der Fähigkeit zeige, dem anderen zuhören zu können, anstatt zu versuchen, ihn „gleich niederzumachen“: Gegen diesen Kanon einer christlichen Gesprächskultur habe sie, so werfe ich Frau Gabriel vor, mit ihren zum Teil auch direkt auf meine Person zielenden Angriffen deutlich verstoßen, und dies öffentlich und gegenüber einem Abwesenden, der sich nicht verteidigen konnte.
Der Brief schließt mit den Worten: „Ich bin mir bewusst, dass wir alle fehlbar sind und uns oft in der Hitze des Gefechts – nicht zuletzt aufgrund von Voreingenommenheit – Dinge entgehen oder Fehler unterlaufen, die wir erst im Nachhinein als solche erkennen. Umso mehr schien es mir wichtig, Ihrer Kritik entgegenzuhalten, was ich wirklich vertrete, und meine Klarstellung auch einer weiteren Öffentlichkeit bekannt zu machen. Nur so kann diese Auseinandersetzung in offener und fairer Weise fortgeführt werden. In diesem Sinne hoffe ich, dass dieses Schreiben ein Beitrag zur Versachlichung ist.“
Martin Rhonheimer / Wien 12. 1. 2021
Teilen auf
- Armut
- Blog
- Christliche Soziallehre
- Familie
- Featured Content
- Gerechtigkeit
- Gesundheitssystem
- Gewerkschaften
- Kapitalismus und Marktwirtschaft
- Marktversagen
- Martin Rhonheimer
- Menschenwürde
- Ordoliberalismus
- Österreichische Schule der Nationalökonomie
- Pensionen und Renten
- Philosophie und Ethik
- Politische Philosophie
- Preissystem
- Rechtsstaat
- Regulierung
- Soziale Gerechtigkeit
- Soziale Marktwirtschaft
- Sozialphilosophie
- Sozialpolitik
- Sozialstaat
- Staat und Politik
- Subsidiaritätsprinzip
- Umverteilung
- Wachstum und Wachstumspolitik
- Wettbewerb