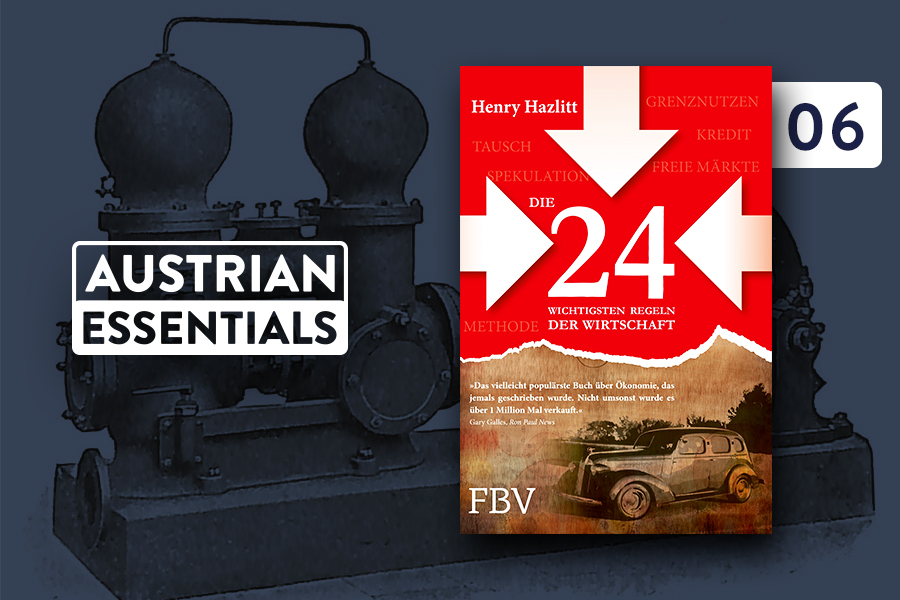
Zu den unausrottbarsten wirtschaftlichen Trugschlüssen überhaupt gehört der Glaube, dass Maschinen Arbeitslosigkeit schaffen: Dieser Irrglaube spiegelt sich in sämtlichen Sonderbehandlungspraktiken wider, die von den Gewerkschaften durchgesetzt wurden. Im März 1941 zählte ein Mitarbeiter des US-Justizministeriums vor einem Wirtschaftsausschuss (dem „Temporary National Economic Committee“) einige dieser Praktiken auf:
So legten etwa mehrere Regionalverbände der Malergewerkschaft Beschränkungen für den Einsatz von Spritzpistolen fest, damit weiterhin langsameres Arbeiten mit dem Pinsel erforderlich war. Die Gewerkschaft der Elektriker in New York weigerte sich, nicht im Bundesstaat New York hergestellte elektrische Anlagen einzubauen, sofern diese nicht auf der Baustelle zerlegt und wieder zusammengesetzt würden. In Houston (Texas) wiederum verlegten der Gewerkschaft angehörende Arbeiter vorgefertigte Rohre nur dann, „wenn das Gewinde an einem Rohrende abgesägt und auf der Baustelle ein neues Gewinde geschnitten wurde.“ Ein regionaler Verband der Gewerkschaft der LKW-Fahrer verlangte, in jedem in das New Yorker Stadtgebiet einfahrendem Lastwagen müsse neben dem . In mehreren Städten hatte eine Vereinbarung der Gewerkschafter zur Folge, „dass bei jedem Bauvorhaben, für das eventuell Elektrizität oder sonstige Energie gebraucht wurde, ganztags ein Wartungselektriker anwesend sein müsse, der aber keinerlei Elektroarbeiten durchführen durfte.“ In der Praxis bedeutete dies: Der Wartungselektriker verbrachte den Tag damit, zu lesen oder Solitaire zu spielen, und nichts weiter zu tun, „als bei Arbeitsbeginn und bei Feierabend einen Schalter umzulegen.“
Maschinen steigern die Produktion und erhöhen den Lebensstandard.
Alle diese Maßnahmen dienten der Arbeitsbeschaffung. Es gab noch weitere solche Praktiken in anderen Bereichen:
„Bei den Eisenbahnern bestand die Gewerkschaft darauf, dass Feuerwehrmänner auf Lokomotiven angestellt werden, die derartige Vorsichtsmaßnahmen gar nicht brauchten. An den Theatern forderte die Gewerkschaft den Einsatz von Kulissenschiebern auch bei Stücken, in denen gar keine Kulisse verwendet wurde. Die Musikergewerkschaft verlangte in vielen Fällen die Verpflichtung sogenannter Ersatzmusiker oder sogar ganzer Ersatzorchester, wo nur Musik aus der Konserve gebraucht wurde.“
Alle diese Praktiken sollten nicht nur Arbeitsplätze schaffen, in ihnen schlug sich auch die Angst vor arbeitssparenden Maschinen nieder, von denen man annahm, dass sie Arbeitsplätze kosten würden. Wie weit die Angst vor solchen Maschinen war, belegt ein Artikel der Ehefrau von US-Präsident Franklin D. Roosevelt, der am 19. September 1945 erschienen ist: „Wir haben inzwischen einen Punkt erreicht, wo arbeitsparende Anlagen nur dann gut sind, wenn sie dem Arbeiter nicht seine Stellung nehmen“, heißt es dort.
Der Angst vor Maschinen ist nicht neu
Zu der Verbreitung solcher Ideen hatte in den USA eine Gruppe, die sich selbst als „Technokraten“ bezeichnete, maßgeblich beigetragen. Im Depressionsjahr 1932 gab sie den Maschinen die Schuld an der damaligen Arbeitslosigkeit. Binnen weniger Monate hatten sich ihre Vorstellungen „wie ein Lauffeuer im ganzen Land verbreitet“. Schon bald machten sich die Technokraten aber mit abstrusen Zahlen und Vorstellungen lächerlich, doch ihre Ansichten hielten sich und fanden etwa in den Sonderbehandlungen der Gewerkschaften ihren Niederschlag.
Die Technokraten hielten ihre Idee von der Arbeitsplätze zerstörenden Kraft der Maschinen für eine revolutionäre neue Entdeckung. Nichts war falscher als das. Bereits zu Beginn des 19. Jahrhunderts zerschlugen englische Maschinenstürmer die Strumpfwirkmaschinen, die maschinellen Webstühle und die Schermaschinen. So löste etwa die Aufstellung der ersten Strumpfwirkmaschinen Tumulte mit mehr als 1000 Menschen aus. Die Arbeiter, die damals Strümpfe noch in Handarbeit herstellten, „brannten Häuser nieder, und die Eigentümer der Betriebe, in denen die neuen Maschinen standen, wurden bedroht und mussten fliehen. Ruhe trat erst ein, nachdem man das Militär gerufen hatte und die Rädelsführer entweder deportiert oder gehängt worden waren.“
Gleiches geschah zu Beginn der Industriellen Revolution als Richard Arkwright im Jahr 1760 die Spinnmaschine mit automatischer Garnzuführung erfand. „Gegen die Einführung der Arkwright’schen Erfindung wurde mit der Begründung Widerstand geleistet, sie bedrohe die Lebensgrundlage der Arbeiter. Der Proteste mussten mit Gewalt niedergeschlagen werden.“
Fakten widerlegen die Technikfeinde
Nüchterne Zahlen entkräften die Behauptungen der Maschinenstürmer. So arbeiteten in England zu der Zeit, als Arkwright die Spinnmaschine entwickelte, geschätzte 5200 Menschen am Spinnrad und etwa 2700 als Weber. Kurz: 7900 Personen waren mit der Herstellung von Baumwollstoffen beschäftigt. „1787, 27 Jahre nach Bekanntwerden der Erfindung, zeigte eine parlamentarische Untersuchung, dass die Zahl der Personen, die tatsächlich mit dem Spinnen und Weben von Baumwolle beschäftigt waren, von 7900 auf 320.000 gestiegen war, eine Erhöhung um 4050 Prozent.“
Die Entwicklung der Strumpfwirkmaschinen wiederum löste, wie William Felkin 1867 in seiner „History of the Machine-Wrought Hosiery Manufactures“ (Geschichte der maschinellen Wirkwarenherstellung) festhielt, tatsächlich Armut und Elend unter den 50.000 englischen Strumpfstrickern aus, aus denen sich der Großteil erst nach 40 Jahren befreien konnte. „Aber soweit die Aufrührer glaubten, und die meisten taten das zweifelsohne, dass die Maschinen immer mehr Arbeiter verdrängen würden, irrten sie sich. Denn bereits vor Ende des 19. Jahrhunderts beschäftigte die Strumpfindustrie mindestens 100 Menschen, wo sie zu Beginn des Jahrhunderts nur einen Arbeiter beschäftigt hatte.“
Es gibt noch unzählige weitere Beispiele. „Man könnte ganze Berge von Zahlen anführen, um nachzuweisen, wie unrecht die Gegner der Technik in der Vergangenheit hatten. Aber das nützt nichts, solange wir nicht genau begreifen, warum sie unrecht hatten.“ Alle Fakten reichen nicht aus, um die Gegner der Technik zu widerlegen, denn diese behaupten jedes Mal: „Das mag früher durchaus gestimmt haben, aber heute sind die Umstände doch grundlegend anders, und wir können es uns einfach nicht leisten, noch weiter arbeitssparende Maschinen zu entwickeln.“ Es geht also darum zu begreifen, warum die Einführung arbeitssparender Maschinen diese Folgen haben musste.
Die Technik-Kritik führt zu absurden Schlussfolgerungen
Zunächst gilt es, eines sich vor Augen zu halten: Die Ansicht, Maschinen würden Arbeitslosigkeit bewirken, führt – logisch und konsequent zu Ende gedacht – zu sinnlosen Konsequenzen. Der schwedische Ökonom und Nobelpreisträger Gunnar Myrdal forderte etwa in seinem Buch „The Challenge of World Poverty“, man solle in den Entwicklungsländern keine arbeitssparenden Maschinen einsetzen, weil sie „die Nachfrage nach Arbeitskräften verringern“. Konsequent weitergedacht müsste man daraus den Schluss ziehen, „jegliche Arbeit so unwirtschaftlich und unproduktiv wie möglich zu machen.“
Bereits Adam Smith hat im zweiten Kapitel seines bekanntesten Werks („Der Wohlstand der Nationen“, 1776) beschrieben, wie ein Nadelmacher „nur mit Mühe eine Nadel am Tag, und ganz sicher keine zwanzig herstellen konnte“. Erst durch die Beschaffung bestimmter Maschinen konnte er die Produktion auf 4800 Nadeln pro Tag steigern. Folgt man der Logik der Technikkritiker, müsste man nun meinen: „So hatte also jede Maschine, die aufgestellt wurde, schon zu Zeiten von Adam Smith zwischen 240 und 4800 Nadelmacher arbeitslos gemacht. Allein in der nadelherstellenden Industrie musste es 99,98 Prozent Arbeitslose geben, wenn es zutraf, dass die Maschinen den Menschen die Arbeit wegnahmen.“
Kurz gesagt: Wenn es zuträfe, dass die Anschaffung arbeitssparender Maschinen die Ursache wachsender Arbeitslosigkeit ist, dann gäbe nur eine einzige logische, freilich absolut revolutionäre Schlussfolgerung: „Wir müssten nicht nur den gesamten zukünftigen technischen Fortschritt als ein Unglück betrachten, sondern auch den der Vergangenheit.“
Was gerne übersehen wird: Die Verwendung arbeitssparender Maschinen entspricht vor allem der Art und Weise, wie Menschen seit eh und je die alltäglichen Aufgaben ihres Lebens zu lösen versuchen. Sie ist nicht nur für den Unternehmer charakteristisch: „Tagtäglich versuchen wir, jeder auf seinem Gebiet, den Aufwand für ein bestimmtes Ergebnis zu verringern. Wir alle bemühen uns, den eigenen Arbeitsaufwand niedrig zu halten, die für ein bestimmtes Ziel notwendigen Mittel haushälterischer einzusetzen. Jeder Angestellte, der kleine wie der große, versucht ständig, seine Aufgaben noch wirtschaftlicher zu lösen, das heißt, durch das Einsparen von Arbeit.“
All die Kreativität, die wir aufbringen, um Aufgaben schneller, besser, effizienter zu Ende zu bringen, müsste von den Gegnern der Technik, wären sie konsequent, „nicht nur als nutzlos, sondern als geradezu schädlich“ abgetan werden.
Maschinen machen Menschen nicht arbeitslos, sondern steigern die Zahl der Arbeitsplätze
Die Behauptung der Technik-Gegner ist schlicht falsch: „Maschinen, technologische Verbesserungen, Automation, Einsparungen und wirtschaftliches Verhalten bei den Unternehmern machen die Menschen nicht arbeitslos.“ Das lässt sich sehr konkret anhand eines Beispiels aufzeigen. Selbst wenn die Einzelheiten je nach den Bedingungen in der jeweiligen Branche unterschiedlich sind, so berücksichtigt das Beispiel doch „die wesentlichen Möglichkeiten“:
Ein Bekleidungsprozent stellt eine Maschine auf, die Damen- und Herrenmäntel mit dem halben Arbeitsaufwand herstellt. Gleichzeitig entlässt er die Hälfte seiner Arbeiter. Zunächst bedeutet das einen Nettoverlust an Beschäftigung, wenn auch nicht einen so hohen, wie manche meinen, denn für die Herstellung der Maschinen sind ebenfalls Arbeiter erforderlich, deren Arbeitsplätze es ohne die neuen Maschinen nicht gäbe. Doch in Summe liegt ein Verlust an Arbeitsplätzen vor: „Wir können nicht damit rechnen, dass der Arbeitsaufwand für die Produktion der Maschinen ebenso viel an Löhnen gekostet hat wie der Arbeitsaufwand, den der Bekleidungsproduzent langfristig durch den Erwerb der Maschinen zu sparen hofft. Sonst wäre es unwirtschaftlich gewesen, und er hätte sie nicht gekauft.“
(Es besteht freilich selbst bei dieser ersten Auswirkung einer Anschaffung einer arbeitssparenden Maschine die realistische Möglichkeit, dass die Beschäftigung zunimmt. „Denn der Bekleidungshersteller erwartet, nur langfristig durch den Kauf der Maschinen Geld zu sparen; unter Umständen dauert es mehrere Jahre, bis die Maschinen ‚sich bezahlt machen’.“)
Auf die erste Auswirkung – Verlust an Arbeitsplätzen – folgen aber noch weitere: „Nachdem die Maschinen Einsparungen erbracht haben, die zum Augleich ihrer Kosten ausreichen, macht der Bekleidungshersteller mehr Gewinn als bisher. (Wir wollen annehmen, dass er seine Mäntel zu den gleichen Preisen wie seine Konkurrenten verkauft und nicht anstrebt, sie zu unterbieten.“) Der Produzent muss diesen Zusatzgewinn nun auf mindestens eine von drei Arten ausgeben – vermutlich auf alle drei, aber in unterschiedlich starkem Ausmaß: 1) Er kauft weitere Maschinen, um zu expandieren; 2) er investiert in anderen Wirtschaftsunternehmen; 3) er erhöht seinen Konsum. „Gleichgültig für welche der drei Möglichkeiten er sich entscheidet, er verbessert dadurch die Beschäftigungslage.“
Somit zeigt sich nun: Der Produzent verfügt jetzt über einen Gewinn, den er andernfalls nicht gehabt hätte, und mit dem er indirekt mindestens so viele Arbeitsplätze finanziert, wie er direkt aufgegeben hat: „Jeden US-Dollar, der er an Löhnen für seine früheren Mantelschneider eingespart hat, muss er jetzt als indirekte Löhne an die Arbeiter des Produzenten der neuen Maschine zahlen oder an die Arbeiter eines anderen Kapital nachfragenden Unternehmens oder an die Beschäftigten, die für ihn ein neues Haus oder einen Wagen bauen oder Juwelen und Pelze für seine Frau herstellen.“
Doch bei diesen weiterreichenden Auswirkungen bleibt es ebenfalls nicht: Nun wird der Produzent dank seiner höheren Gewinne entweder auf Kosten seiner Konkurrenten expandieren, oder diese beschaffen sich ebenfalls neue Maschinen. Dadurch erhalten neuerlich mehr Beschäftigte als bisher in der Maschinenfabrik Arbeit.
Der wachsende Wettbewerb beginnt sodann die Preise für Mäntel zu drücken. Nun sinkt die Gewinnrate der Hersteller und „die Einsparungen werden allmählich an die Käufer der Mäntel weitergegeben – an die Verbraucher.“ Sofern die Nachfrage nach Mänteln elastisch ist – das heißt, bei sinkenden Mantelpreisen werden mehr Mäntel gekauft, und umgekehrt – bedeutet das: Die Menschen kaufen mehr Mäntel, es werden daher auch mehr produziert als vorher, und somit finden mehr Menschen in der Mantelindustrie Beschäftigung als vor Einführung der neuen Maschinen. Genau das ist bei den Strumpfmachern und anderen Textilherstellern geschehen (siehe oben).
„Aber die neuen Arbeitsplätze hängen nicht von der Elastizität der Nachfrage nach dem betreffenden Erzeugnis ab.“ Sollten die Verbraucher gleich viele Mäntel wie vorher – von derselben Qualität, aber deutlich billiger – kaufen, so bleibt ihnen mehr Geld zurück, mit dem sie nun andere Produkte kaufen, sodass sie Beschäftigung in anderen Branchen schaffen.
Absolut betrachtet haben Maschinen die Zahl der Arbeitsplätze enorm gesteigert. Seit der Mitte des 18. Jahrhunderts, als die Industrielle Revolution begonnen hat, hat sich die Weltbevölkerung vervielfacht. Ohne die Maschinen hätte man diese hohe Anzahl an Menschen überhaupt nicht versorgen können. „Man kann folglich behaupten, dass 75 Prozent der Menschen heute den Maschinen nicht nur ihren Arbeitsplatz, sondern auch ihr Leben verdanken.“
Nicht alle Maschinen sind arbeitssparend
Das Beispiel der arbeitssparenden Maschine für Mantelhersteller betrifft genau jene Art von Maschine, auf die sich die Technikgegner besonders gerne stürzen. Näher besehen gibt es freilich auch noch ganz andere Maschinen, die überhaupt keine Arbeitsplätze einsparen:
„Einige, wie etwa Präzisionsinstrumente, Nylon, bestimmte Kunstharze, Sperrholz oder Kunststoffe aller Art verbessern einfach die Qualität der Erzeugnisse. Andere, wie das Telefon oder das Flugzeug, erbringen Leistungen, zu denen der Mensch mit direkter Arbeit gar nicht in der Lage ist. Wieder andere lassen Gegenstände und Dienstleistungen entstehen, die es sonst gar nicht gäbe, wie Röntgengeräte, Radios, Fernsehgeräte, Klimaanlage und Computer.“
Gelegentlich wird behauptet, Maschinen würden immer mehr Arbeitsplätze schaffen. Das stimmt aber nur unter ganz bestimmten Umständen und in speziellen Branchen, allerdings nicht nur in der Textilbranche. So arbeiteten 1910 „in den Vereinigten Staaten in der noch jungen Automobilindustrie 140.000 Menschen. 1920, als die Wagen schon besser und auch preiswerter waren, beschäftigte die Branche 250.000 Menschen. Da die Verbesserungen und Kostensenkungen anhielten, lag die Beschäftigung 1930 bei 380.000. 1973 war sie auf 941.000 gestiegen. … So ist es dank neuer Erfindungen und sinkender Kosten in vielen neugeschaffenen Branchen gewesen.“
Die eigentliche Aufgabe von Maschinen besteht darin, Lebensstandard und Produktion zu erhöhen
„Es ist jedoch falsch, die Aufgabe oder den Erfolg der Maschine in erster Linie darin sehen zu wollen, Arbeitsplätze zu schaffen. Der eigentliche Erfolg der Maschinen ist die Erhöhung der Produktion, die Steigerung des Lebensstandards, die Mehrung des wirtschaftlichen Wohlstands.“ Dies geschieht auf zweierlei Arten: Entweder werden die Produkte dank der Maschinen billiger (wie im Beispiel der Mäntel), oder die Maschinen bewirken eine Erhöhung der Löhne, weil sie die Produktivität der Arbeiter verbessern. Manchmal bewirken Maschinen beides. „Was tatsächlich geschieht, hängt wesentlich von der Geldpolitik ab, die im jeweiligen Land betrieben wird. Auf jeden Fall erhöhen Maschinen, Entdeckungen und Erfindungen die Reallöhne.“
Die Vollbeschäftigung in armen Ländern ist unfreiwillig und nicht erstrebenswert
Andererseits ist nicht jede Form von Vollbeschäftigung erstrebenswert. Gerade in rückständigen Wirtschaften kann es durchaus kein Problem sein, alle zu beschäftigen: „Vollbeschäftigung – Überbeschäftigung; langes, beschwerliches, unmenschliches Arbeiten – ist charakteristisch für gerade die Länder, die industriell am weitesten zurückgeblieben sind.“ Die Einführung von arbeitssparenden Maschinen hebt in solchen Ländern den Lebensstandard schafft in der Regel mehr freiwillige Nicht-Beschäftigung, „weil es sich die Menschen jetzt leisten können, weniger Stunden zu arbeiten, während Kinder und alte Menschen überhaupt nicht mehr zu arbeiten brauchen.“
Man muss unmittelbare und mittelbare Auswirkungen im Blick haben
Man sieht auch hier: Wer nur die unmittelbaren Auswirkungen einer Maßnahme auf bestimmte Gruppen im Blick hat, nicht aber die mittelbaren auf die Gemeinschaft als ganze, gelangt zu falschen wirtschaftspolitische Schlussfolgerungen. Nur dieser verengte Blick führt zur Annahme, Maschinen würden Menschen arbeitslos machen. Man sieht dann nur auf Herrn Maier, der seinen Arbeitsplatz wegen einer neuen Maschine verliert, übersieht aber Herrn Schmidt, der einen Arbeitsplatz zur Herstellung der Maschine bekommen hat, und Herrn Lehmann, der nun die neue Maschine bedient, sowie Frau Huber, die jetzt einen Mantel zur Hälfte des Preises kaufen kann.
Dennoch darf man Herrn Maier nicht vergessen: Vielleicht findet er einen neuen, besseren Arbeitsplatz, vielleicht landet er aber auch in der Arbeitslosigkeit, weil es für seine Spezialkenntnisse, die er jahrelang erworben hat, keine Verwendung mehr gibt. Die Frage, ob man Herrn Maier nun Arbeitslosengeld zahlt, ihn sich selbst überlässt, oder auf Staatskosten umschulen lässt, bringt vom Thema dieses Kapitels ab. Der tragische Fall des Herrn Maier kommt, wie noch später gezeigt wird, fast überall dort vor, „wo es technischen und wirtschaftlichen Fortschritt gibt“. Entscheidend ist daher: Wir sollten versuchen, „alle wichtigen Auswirkungen jeder Wirtschaftspolitik oder Entwicklung zu sehen – die unmittelbaren für bestimmte Gruppen und die langfristigen, die alle Gruppen betreffen.“ Man sollte also nicht von einem Extrem ins andere fallen:
„Es war das große Verdienst der klassischen Wirtschaftstheoretiker, auf die mittelbaren Folgen einzugehen und die langfristigen Auswirkungen einer bestimmten Wirtschaftspolitik oder Entwicklung auf die Gemeinschaft zu untersuchen. Aber darin lag gleichzeitig der Mangel. Da die Analysen langfristig und umfassend angelegt waren, wurde der kurzfristige, spezielle Aspekt manchmal vernachlässigt. Zu oft neigten die Klassiker dazu, die unmittelbaren Auswirkungen einer Entwicklung auf bestimmte Gruppen entweder herunterzuspielen oder völlig zu vergessen.“ Das demonstriert etwa das Beispiel der englischen Strumpfmacher, die „durch das Aufkommen der neuen Strumpfwirkmaschinen in größte Not gerieten, eine der ersten Auswirkungen der Industriellen Revolution.“
Die hier gebotene, exklusiv für die AUSTRIAN ESSENTIALS erstellte Kurzfassung von „Die 24 wichtigsten Regeln der Wirtschaft“ erscheint mit Erlaubnis des FinanzBuch Verlags, bei dem auch die deutsche Fassung der 1978 erschienenen aktualisierten Neuauflage des Klassikers erhältlich ist.
