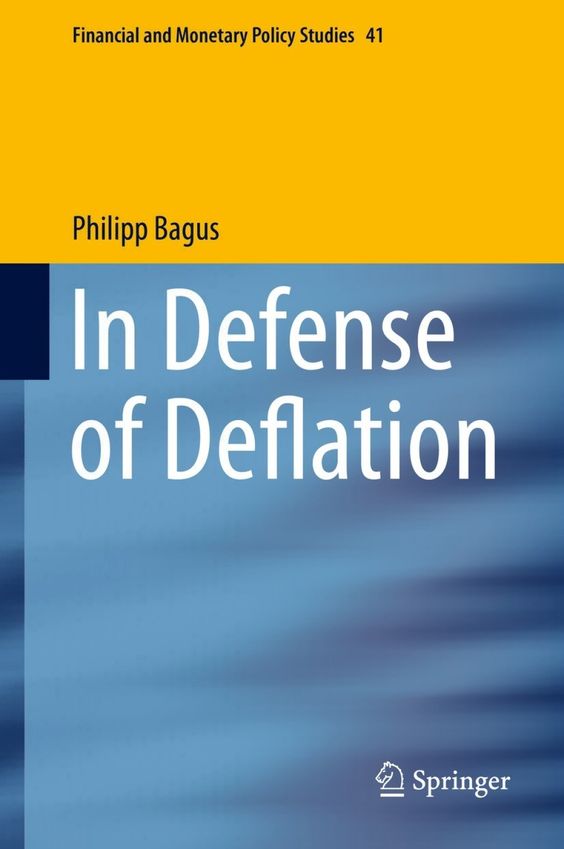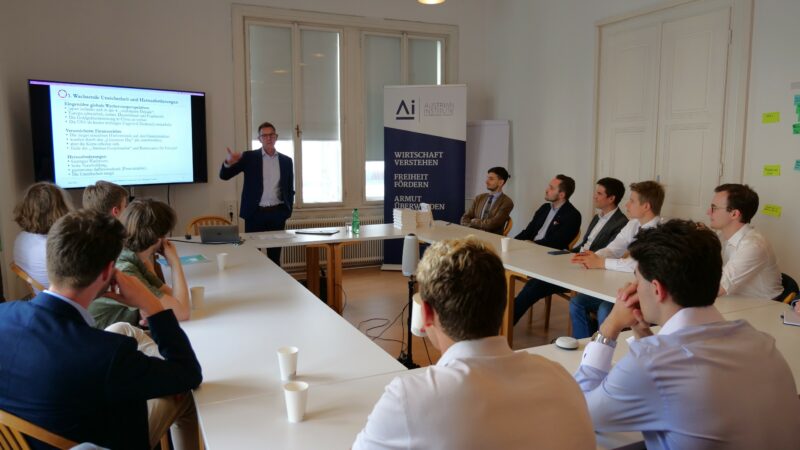Heerscharen von Arbeitslosen, zahlungsunfähige Unternehmer, Bankenkrise, soziales Elend: Die Weltwirtschaftskrise der späten 1920er und der 1930er gilt als Schreckensszenario einer Deflationsspirale. Doch rechtfertigt sie die heutigen Warnungen vor einer Deflation?
Heerscharen von Arbeitslosen, zahlungsunfähige Unternehmer, Bankenkrise, soziales Elend: Die Weltwirtschaftskrise der späten 1920er und der 1930er gilt als Schreckensszenario einer Deflationsspirale. Doch rechtfertigt sie die heutigen Warnungen vor einer Deflation? Das Verhindern von Deflation zählt heute zu den zentralen geldpolitischen Zielen der Notenbanken. „Eine anhaltende Deflation kann für eine moderne Wirtschaft zerstörerisch sein und sollte entschieden bekämpft werden“, erklärte etwa der ehemalige Fed-Chef Ben Bernanke. Sämtliche Maßnahmen zur Verhinderung von Deflation hielt Bernanke für gerechtfertigt: Selbst bei einem Senken des Leitzinses auf Null hätte die Zentralbank noch nicht ihr Pulver verschossen. Weitere sinnvolle Schritten seien dann das Ankaufen von Staatsanleihen und das Pumpen von noch mehr Zentralbankgeld in das Bankensystem.
Philipp Bagus, Professor für Volkswirtschaft an der Universidad Rey Juan Carlos in Madrid, hält diese Angst vor Deflation für unbegründet. Mehr noch: in zahlreichen Fällen sei Deflation sogar erfreulich, dafür aber die von Bernanke geforderte ultralockere Geldpolitik höchst schädlich, vor allem für den Konsumenten. Das Austrian Institute sprach mit Bagus über die verschiedenen Formen von Deflation, Deflationsspiralen in den 1930er Jahren in Deutschland und in den 1990er Jahren in Japan und über die gegenwärtigen Aussichten für den Euro-Raum.
Philipp Bagus ist Professor für Volkswirtschaft an der Universidad Rey Juan Carlos in Madrid. Er ist Autor zahlreicher Bücher, darunter „In Defense of Deflation“, „Die Tragödie des Euro“ und „Warum andere auf Ihre Kosten immer reicher werden“ (gemeinsam mit Andreas Marquart). Zu seinen Forschungsschwerpunkten Geld- und Konjunkturtheorie veröffentlichte er in internationalen Fachzeitschriften wie Journal of Business Ethics, Independent Review, American Journal of Economics and Sociology u.a. Seine Arbeiten wurden mit dem O.P.Alford III Prize in Libertarian Scholarship, dem Sir John M. Templeton Fellowship und dem IREF Essay Preis ausgezeichnet.
Sie teilen die gängige Angst vor Deflation nicht. Nun gibt es aber verschiedene Formen von Deflation. Müsste man da nicht unterscheiden?
Philipp Bagus: Ja, da kann man schon unterscheiden. Die Angst, es bestünde hier ein gesamtwirtschaftliches Problem und fallende Preise seien an sich ein Problem, ist aber übertrieben.
Es gibt zum einen die Wachstumsdeflation: Sinkende Preise aufgrund von Wachstum sollten uns eher mit Freude erfüllen. Auch vor Deflation wegen erhöhter Geldnachfrage braucht sich niemand zu fürchten. Es kommt auch immer darauf an, wie es zur Erhöhung der Geldnachfrage kommt. Wenn ich mehr Liquidität haben will, spare ich entweder weniger pro Monat, oder ich konsumiere weniger. Wenn ich beides gleichmäßig verringere, dann gibt es real gar keinen Effekt, es sinken nur die Preise.
Dann gibt es noch die Kreditdeflation. Sie kann nur dann eintreten, wenn vorher eine Kreditexpansion stattgefunden hat. In diesem Fall hilft die Deflation, Verzerrungen schneller zu beseitigen. Vor einer solchen Deflation müssen natürlich einige Angst haben, nämlich jene, die viele Fehlinvestitionen getätigt haben bzw. diejenigen, die durch ihren Arbeitsplatz und anderes mitbetroffen sind. Mittel- und langfristig ist es aber gut, dass die vielen Fehlinvestitionen durch die Kreditdeflation schneller beseitigt werden.
Eine Deflationsart, die man noch schlecht finden könnte, ist jene durch den Staat. Dass der Staat Preiskontrollen einführt, also die Preise unter dem Marktniveau ansetzt oder Geld zerstört, könnte man aus ethischer Sicht als schlechte Deflation ansehen.
Sie halten eine Kreditdeflation zwar für schmerzhaft, aber unvermeidlich?
Unvermeidlich nicht. Man kann es ja so machen wie heutzutage, dass man sie vermeidet, indem man einfach immer mehr Liquidität in den Markt gibt. Dann kriegt man eine Zombifizierung der Wirtschaft.
Das ist aber noch schädlicher.
Aus Sicht der freien Konsumenten, ja. „Fehlinvestition“ bedeutet ja, dass die Konsumenten eigentlich etwas anderes haben wollen. Wenn ich die Fehlinvestitionen dadurch künstlich erhalte, dass ich die Zinsen auf Null oder ins Negative senke, dann ist das nicht im Sinne der Konsumenten.
Als warnendes Beispiel für die verhängnisvollen Wirkungen einer Deflation wird oft die „Große Depression“ der 1930er Jahre angeführt. Sehen Sie diese Krise als Folge einer Kreditdeflation nach vorangegangener Kreditexpansion?
Ja. In meinem Buch „In Defense of Deflation“ (s. Kasten) bin ich auf zwei Beispiele von Deflation eingegangen. Ein Beispiel ist die Wachstumsdeflation in den USA nach dem Bürgerkrieg. Über 30 Jahre lang gab es fallende Preise, was dem Wachstum keinen Abbruch getan hat. Im Gegenteil: Die Preise sind gerade wegen des Wachstums gefallen. Das zweite Beispiel war die Deflation in Deutschland in den 1930er Jahren. Dort ist genau das passiert: eine Kreditdeflation. Deshalb interpretiere ich auch die Deflationspolitik Heinrich Brünings (deutscher Reichskanzler von 1930 bis 1932) etwas anders und positiver als andere.
Die wird ja immer kritisiert. John Maynard Keynes zufolge hätte man die Nachfrage ankurbeln sollen. Milton Friedman und anderen Vertretern des Monetarismus zufolge hätte man die Geldmenge nach dem Bankencrash von 1929 stärker erhöhen sollen. Beide Standpunkte sind weit verbreitet. Was halten Sie davon?
Die Federal Reserve hat ja damals die Zinsen gesenkt und war expansiv, aber Friedman meint, nicht expansiv genug. Das Wichtigste, was die Kreditrestriktion bewirkt, ist Fehlinvestitionen schneller zu liquidieren und dadurch auch Ressourcen freizumachen, sodass diese Ressourcen wieder für nachhaltige, neue Projekte zur Verfügung stehen. Es fallen die Preise der Produktionsfaktoren, d.h. die Kosten sinken, und dadurch werden neue Projekte rentabel.
Zu Beginn der 1920er Jahre hatte es eine ähnliche Depression in den USA gegeben. Nur haben die damaligen US-Präsidenten so gut wie nichts unternommen, und nach ein paar Monaten war die Depression vorbei. Der Grund, weshalb die „Große Depression“ solange gedauert hat, waren u.a. die auf den Smoot-Hawley Tariff Act zurückgehenden Schutzzölle und der New Deal. Und so, wie ich die Lage in Deutschland einschätze, hat Hitler den Aufschwung geerntet, nachdem Brüning zuvor die „harte Arbeit“ geleistet hat, indem er etwa die Löhne im Öffentlichen Dienst gesenkt und die Staatsausgaben begrenzt hat. Die Bereinigung war im Gange und fast durchgestanden; dann kam Hitler an die Macht.
„Eine Kreditdeflation braucht nicht lange zu dauern“
Sie halten die gängigen Schlussfolgerungen aus der „Großen Depression“ für falsch: Die Geldmengenausweitung macht es Ihnen zufolge nur schlimmer?
Ja. Eine Kreditdeflation braucht nicht lange zu dauern, wenn die Märkte flexibel sind. Dann werden die Produktionsfaktoren in eine andere Richtung gelenkt und sind dann wieder produktiv. Die Alternative ist, dass man die Fehlinvestitionen künstlich aufrechterhält.
Also mit anderen Worten: eine kurze, aber schmerzvolle Operation.
Genau.
Diese „Große Depression“ hat damals sämtliche Ökonomen überrascht, nicht aber die Vertreter der Österreichischen Schule. Eigentlich hätten sie zu den Rising Stars der Ökonomie werden müssen, doch wenige Jahre später war das Gegenteil der Fall. Es scheint, man hat Rezepte zur Beendigung der Krise gesucht, die dann aber nicht bei den „Österreichern“ gefunden wurden, sondern bei Keynes. Könnte das der Grund dafür gewesen sein, dass die Österreichische Schule, obwohl sie als einzige die Krise prognostiziert hat, an Einfluss verloren hat?
Das ist eine interessante Frage. Vielleicht hat man, weil die Krise so lange gedauert hat, nicht gesehen, dass sich die Erholung nur wegen der Eingriffe des New Deals und der Zölle verzögert hat. So dachte man, der Staat müsse noch mehr tun, und dafür hat dann Keynes die Theorie geliefert.
Aber irgendwann ging es ja mit den USA wieder aufwärts.
Aus der Krise kamen sie erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Vollbeschäftigung haben sie zuvor erreicht, als sie alle als Soldaten an die Front geschickt haben. Dann hat man keine Arbeitslosen mehr. Allerdings war das keine Erholung aus Sicht der Konsumenten, denn so dient man ja nicht ihren Bedürfnissen: Die Konsumenten wollen keine Panzer, Flugzeuge oder Bomben; vor allem wollen sie nicht an der Front verheizt werden.
Als anderes warnendes Beispiel für Deflation aus jüngerer Zeit gilt Japan. Kürzlich hat Finnlands Notenbank-Chef Olli Rehn die ultralockere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) mit Verweis auf Japan verteidigt. Seine Argumentation: Die Deflationsspirale, die Japan seit den 1990er Jahren erlebt, müsse vorbeugend verhindert werden. Daher sei es besser, die Inflation nach oben zu drücken, anstatt das Risiko einer anhaltenden Deflation einzugehen. Wie interpretieren Sie die Situation in Japan?
Japan hat doch genau das getan: Es hat die Zinsen nach dem Krach gesenkt und es folgte eine expansive Fiskalpolitik. Permanent wurde die gleiche Medizin zugefügt, und nun wundert man sich, dass sie noch immer nicht wirkt. Man rennt gegen eine Wand und es klappt nicht, danach rennt man immer wieder und immer heftiger gegen die Wand und wundert sich, dass es immer noch nicht funktioniert. In Japan sind die Unternehmen wie eine Familie, deshalb entlässt man fast nie jemanden. Das macht den Arbeitsmarkt sehr unflexibel. So setzt man die Fehlinvestitionen immer weiter fort. Firmen werden zu Zombies: Sie können nicht leben, aber auch nicht sterben, weil sie sich durch niedrige Zinsen immer noch refinanzieren können. Es werden nie die Ressourcen freigesetzt, um wieder einen nachhaltigen Aufschwung möglich zu machen, weil diese Ressourcen in den Zombies gebunden sind. Das ist das Problem. Dass man jetzt in Europa das Gleiche machen will, ist tragisch für uns.
„Die Deflationsspirale hört auf, wenn die Fehlinvestitionen liquidiert sind“
Aber viele sehen im Japan der 1990er Jahre eine Deflationsspirale am Werk: fehlende Nachfrage, geringere Gewinne für Investitionen, Aufschub des Konsums, Senkung der Kosten durch Unternehmer, und schließlich weniger Kreditvergabe.
Die Spirale hört ja auf, wenn die Fehlinvestitionen liquidiert sind. Dann fallen die Preise von den Produktionsfaktoren, also die Kosten. Dem Unternehmen ist immer der Unterschied zwischen Kosten und Verkaufspreisen wichtig. Die Spanne muss positiv sein. Wenn die Einkaufspreise schneller fallen als die Verkaufspreise, dann steigt ja die Gewinnspanne und es zahlt sich aus zu investieren. Man sieht das auch im Technologiebereich, wo die Verkaufspreise fallen bzw. die Qualität bei gleichbleibenden Preisen steigt. Die Kosten sinken, dadurch erhöht sich die Gewinnspanne.
Die Ökonomie fürchtet aber nicht Deflation in einem bestimmten Bereich, wie etwa die Wachstumsdeflation im IT-Bereich, sondern die gleichzeitige Senkung aller Preise, etwa durch eine Kreditdeflation.
Bei Krediten führt das zu einer Umverteilung von den Schuldnern zu den Gläubigern. Die Schuldner verlieren, die Gläubiger gewinnen. Ergebnis: Die Gläubiger können dann mehr konsumieren und mehr sparen als vorher, und die Schuldner können weniger sparen und weniger konsumieren.
Haushalte, die Immobilien durch Kredite angeschafft haben, können aber in ernsthafte Probleme schlittern. Wenn besonders viele betroffen sind, geraten auch die Banken in Schwierigkeiten. Sie können dann bei der Kreditvergabe zurückhaltend werden, was dann wiederum die Gläubigerseite betrifft. Ist das nicht ein Problem?
Ja, es kommt dann zu einer Art Offenbarungseid und es kann zu massiven Umverteilungen kommen. Ich möchte es ja nicht in Abrede stellen: Hätte man 2007 oder 2008 nicht reagiert, hätten wir eine gewaltige Krise erlebt. Nur muss man sich eines immer vor Augen halten: Der Reichtum einer Gesellschaft besteht aus dem Produktionspotenzial, wie Fabriken, usw. Das wird nicht dadurch tangiert, dass ein Eigentümerwechsel vor sich geht. Ein Beispiel: Ein Firmenbesitzer ist verschuldet und kann die Schulden nicht mehr bezahlen, einfach aus dem Grund, dass er die Last der Nominalzinsen wegen der Preisdeflation nicht mehr bedienen kann, obwohl sein Geschäftsmodell eigentlich funktioniert. Nun erhält der Gläubiger das Unternehmen. Was wird er machen? Wenn das Geschäftsmodell wirklich rentabel ist, wird er es weiterführen. Es wird also weiterproduziert. Der allgemeine Wohlstand der Volkswirtschaft wird vom Besitzerwechsel nicht tangiert. Es verliert nur derjenige, der sich verspekuliert und zu hoch verschuldet hat. Möglicherweise haben das auch viele Haushalte gemacht. Andererseits stehen Haushalte aber auch auf der Gläubigerseite mit ihren Anlagen. Es kommt auf den individuellen Fall an, ob man am Ende Gewinner oder Verlierer ist, aber wenn jemand Verlierer ist, ist ein anderer auch Gewinner.
„Es ist ein Irrglaube, dass bei Preisdeflation keiner mehr investiert“
Sehen Sie nicht Gefahren für den Bankensektor und besonders für die Kreditvergabe?
Es kann passieren, dass das Bankensystem Bankrott geht. Dann könnten aber wieder neue Banken entstehen, sodass womöglich ein nachhaltiges Bankensystem entsteht, das dann ohne Probleme Kredite vergeben kann. Andererseits kann die Kreditvergabe zusammenbrechen, weil es sehr hohe deflationäre Erwartungen gibt. Das beschleunigt auch das Fallen der Preise, und sobald die Preise auf das erwartete Niveau gefallen sind – und sofern es keine staatlichen Barrieren gibt, kann das sofort geschehen – besteht kein Grund, keine neuen Kredite mehr zu vergeben, vor allem, wenn die Bereinigung passiert.
Heute pumpt man hingegen mit Negativzinsen immer mehr Geld rein, und wundert sich, dass danach wenig weitergeht. Die Verzerrungen sind geblieben und alle sind überschuldet. Das Wirtschaftswachstum wird blockiert, weil die Fehlinvestitionen noch da sind und nicht zugelassen wird, dass sie Platz machen für neue Investitionen.
Thomas Mayer (Flossbach von Storch Research Institute) meint, eine funktionierende Wirtschaft komme in Wahrheit auch ohne Kreditvergabe aus (siehe hier). In den USA sei es ja gang und gäbe, erspartes Geld zu investieren. So seien auch die meisten unternehmerischen Erfolgsgeschichten zustande gekommen.
Ja, das ist richtig. Selbst bei deflationären Erwartungen können Investitionen immer durch Eigenkapital finanziert werden. Bereits bei einer kleinen positiven Rendite besteht dann der Anreiz zu investieren. Ich bekomme das Geld mit einer höheren Kaufkraft zurück, und ich erhalte dafür sogar noch Zinsen bzw. Rendite.
Zentralbanken fürchten die Deflation auch wegen der Liquiditätsfalle: Weil die Notenbanken den Leitzins nicht unter Null senken können, bleibt der kleinst-mögliche Realzins bei einer Deflationserwartung positiv. Das schränkt die Möglichkeit ein, über niedrige oder Null-Zinsen, Anreize für Investitionen zu schaffen.
Bei positivem Realzins aufgrund von deflationären Erwartungen können noch immer Anreize bleiben, zu investieren. Zur höheren Kaufkraft, die das Geld nach einem Jahr hat, kommt noch eine kleine, positive Rendite hinzu. Wenn die Deflation bei zwei Prozent liegt und die positive Gewinnmarge bei nur ein, zwei Prozent, habe ich dann nach einem Jahr nicht nur zwei Prozent mehr, sondern drei oder vier Prozent. Es ist ein Irrglaube, dass bei Preisdeflation keiner mehr investiert. Natürlich: Meine reale Kassenhaltung erhöht sich bei fallenden Preisen automatisch, aber es gibt ja immer noch eine Alternative: Anstatt 100 Euro liegen zu lassen, die nach einem Jahr real 102 Euro wert sind, kann ich auch die Chance nützen zu investieren und bei einem Gewinn von fünf Prozent habe ich dann nominal 105 Euro und real noch 2 Prozent mehr. Es stimmt daher nicht, dass bei fallenden Preisen der Anreiz zu investieren wegfällt.
„In der Inflation sind die Verluste weniger sichtbar und mehr verteilt“
Ist aus Ihrer Sicht die Deflationsangst schlicht und einfach interessegeleitet, aus Angst vor Umverteilung?
Das ist sicherlich ein Faktor. Vor allem: Der größte Schuldner ist der Staat. Darüber hinaus gibt es das, was Thorsten Polleit (Ludwig von Mises Institute Deutschland) die „kollektive Korruption“ nennt: Angesichts der jetzigen Geldpolitik hat jeder den Anreiz, sich zu verschulden; die Arbeitsplätze hängen an verschuldeten Unternehmen, die bei Deflation vielleicht unter die Räder kommen. In einer unflexiblen Wirtschaft finden wir in einer tiefen Bereinigungskrise nicht so schnell einen neuen Arbeitsplatz, da wir die Nominalschulden nicht mehr bedienen können, womöglich verlieren wir unser Haus.
Es gibt auch noch Public-Choice-Gründe für die inflationäre Geldpolitik: Die Schuldner sind politisch besser organisiert als die Gläubiger. In den USA haben etwa im 19. Jahrhundert die verschuldeten Farmer Druck ausgeübt, damit die Geldnotenpresse angeworfen wird. Für die Geldnutzer gibt es hingegen keine Lobby.
Warum gibt es mehr Angst vor Deflation als vor Inflation, wenn beide symmetrisch sind – sprich: bei Deflation die genau umgekehrte Umverteilung geschieht? Bei Inflation gewinnen die Schuldner und verlieren die Gläubiger, bei Deflation ist es umgekehrt. In der Inflation sind die Verluste weniger sichtbar und mehr verteilt, weil jeder Kaufkraft verliert. Uns ist nicht bewusst, was wir ohne Inflation alles hätten kaufen können. In der Deflation sind die Verluste hingegen konzentrierter und sichtbarer. Wenn man Bankrott geht, sein Unternehmen verliert oder eine Familie ihr Haus, dann ist das für jeden sichtbar. Es ist daher nachvollziehbar, dass die Angst vor dem einen größer ist als vor dem anderen.
Weltweit und auch in Europa erleben wir seit der Finanzkrise eine ultralockere Geldpolitik. Manche meinen, die EZB werde diese Politik noch 20, 30 Jahre fortsetzen bis alles verstaatlicht ist. Man wird vorher halt noch mehr Staatsanleihen aufkaufen, irgendwann auch Unternehmensanleihen etc.
Da stimme ich voll zu. Man kann immer weiter verstaatlichen, irgendwann hat man dann alles verstaatlicht und dafür keine Arbeitslosen mehr. Im Kommunismus waren eigentlich alle Unternehmen Zombieunternehmen, die vom Staat am Leben erhalten wurden. Zwar gibt es dann keine Arbeitslosigkeit, aber man produziert nicht mehr für die Bedürfnisse der Konsumenten. Der Staat entscheidet, was und wie viel produziert wird.
Über die Geldpolitik schlittern wie unscheinbar in eine Planwirtschaft?
Ja.
Sie sehen nichts, was dem im Euro-Raum Einhalt gebieten könnte?
Wenig. Es müsste im Interesse der Verantwortlichen sein, doch die haben nur Interesse, so weiterzumachen. Alle Personen, die auch nur ein bisschen Kritik im Zentralbank-Rat geübt haben, wurden abserviert oder sind freiwillig gegangen, siehe Axel Weber, Jürgen Stark, Jens Weidmann und andere. Sie sind alle nicht mehr am Ruder. Das ist ja kein Zufall. Und sollte eine noch größere „Riesenkrise“ kommen, sehe ich auch nicht, dass sich etwas daran ändern würde. Dann bestehen eigentlich noch mehr Anreize, so weiterzumachen. Es müsste sich in der Bevölkerung etwas ändern. Die Menschen müssten für stabiles Geld auf die Straße gehen. Vielleicht bei wirklich großen intereuropäischen Umverteilungen könnte das passieren.
In seinem Werk „In Defense of Deflation“ analysiert Philipp Bagus zunächst die Ursachen und Folgen von Deflation. Dabei deckt er mehrere Mythen auf und widmet sich auch den Gründen für die weitverbreitete Angst vor Deflation. Im Gegensatz zu den meisten Ökonomen hält Bagus Deflation auf freien Märkten für vorteilhaft. Anhand von zwei historischen Fallstudien – der Wachstumsdeflation in den USA nach dem Bürgerkrieg und der Deflation in Deutschland während der Weltwirtschaftskrise – untermauert er seine Thesen.