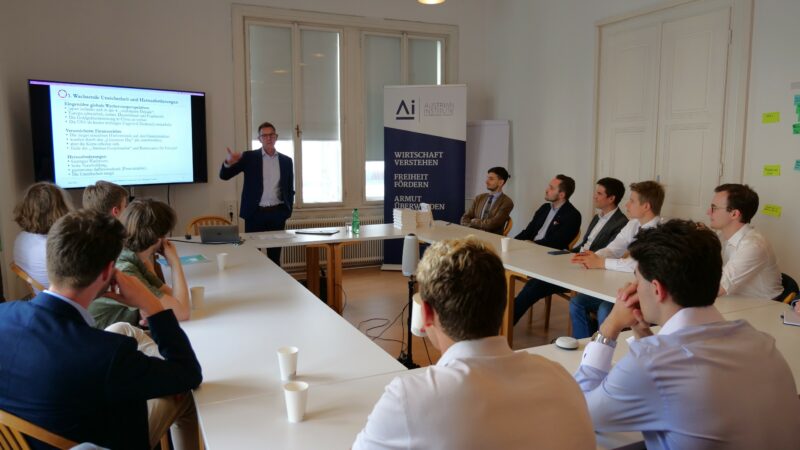Eugen von Böhm-Bawerk (1851-1914), nach Carl Menger wichtigster Mitbegründer der Österreichischen (oder Wiener) Schule der Nationalökonomie, hier als Österreichischer Finanzminister auf der 100-Schilling Note von 1985. (Bild: Wikimedia Commons).
Eugen von Böhm-Bawerk (1851-1914), nach Carl Menger wichtigster Mitbegründer der Österreichischen (oder Wiener) Schule der Nationalökonomie, hier als Österreichischer Finanzminister auf der 100-Schilling Note von 1985. (Bild: Wikimedia Commons). Es ist der Tausch, von dem Ökonomie handelt, nicht nur die Knappheit, wie oft geschrieben wird. Denn viel anderes ist auch knapp, die Liebe, der Friede, gute Politik. Im Tausch treten die zwei Akteure gegeneinander auf, Anbieter und Nachfrager. Sie einigen sich, der Markt wird geräumt – im Einverständnis, ohne Gewalt. Außerdem spezialisieren sie sich – in Arbeitsteilung – und werden produktiver, tauschen und erwerben, was andere besser können. Damit haben die beiden Akteure selbst bestimmt, was gilt und bescheiden sich. Sie sprechen sich den getauschten Wert zu. Eine der zwei Definitionen von Gerechtigkeit ist damit erfüllt – iustitia commutativa. Die andere Gerechtigkeit – die iustitia distributiva, die „Verteilungsgerechtigkeit“, heute zu blosser Umverteilung zu Lasten der Leistungsträger geraten – wird von außen, von der Politik, der Sozialpolitik, durch Besteuerung und Umverteilung darüber hinaus veranstaltet. Sie ist kein Markt, ist nicht Ökonomie (deshalb aber nicht schon gerechter oder wertmäßig richtig).
Der ökonomische Wert ist immer ein „Grenzwert“
Was aber sind ökonomische Werte? Die frühen Klassiker wie Adam Smith und spätere Autoren wie David Ricardo und Karl Marx, glaubten, den Wert von Gütern an den für ihre Produktion aufgewandten Kosten (Smith) oder der dafür verwendeten Arbeit (Ricardo, Marx) festmachen zu können. Als Rechnungs- und Planungsgrundlage scheitert diese Idee jedoch. Sobald jemand Werkzeuge braucht, steigert sich das Ergebnis der Arbeit – aber wie teilt man dies zwischen der vorher in die Schaufel gesteckten Arbeit und dem Schaufeln an sich auf? Wie ist es mit Diensten, die in die Produktion eingehen? Kurz, der österreichische Ökonom Ludwig von Mises sah dies als unmöglich an, und er sagte voraus, planwirtschaftliche Ordnungen würden scheitern.
Alle Beteiligten am Markt, am Tausch, rechnen. Sie bedenken ihren eigenen Nutzen dabei, müssen aber, damit die Gegenseite einhängt, auch deren Nutzen zugestehen.
Dabei stützte er sich auf den Wiener Ökonom Eugen v. Böhm-Bawerk, der folgende, von Carl Menger stammende Erklärung des Grenznutzens popularisiert hatte: Der Wert ist das, was der Käufer zu bezahlen bereit ist, und dies hängt von der letzten noch angebotenen Einheit ab. Für eine einzige angebotene Flasche Wasser bezahlt der Verdurstende viel, für eine Flasche aus einem gefüllten Wassertank, den er bemerkt, fast nichts. Denn mit der zweiten, dritten Flasche wird er sich das Gesicht waschen, und dieser Grenznutzen wird den Preis aller Flaschen bestimmen, die noch aus dem Wassertank abgefüllt werden. Sucht eine Firma verzweifelt Arbeitskräfte für einen großen Auftrag, wirbt sie diese zusätzlich mit höheren Löhnen an, muss aber mit der Zeit allen diesen Tarif bezahlen. Das kann sie auch, weil der Grenznutzen dieser neu Eingestellten hoch ist. Stellt sie aber immer weitere Arbeitskräfte ein, fällt deren Grenzproduktivität, also die zusätzliche Wirkung der Neueinstellungen pro Kopf nimmt ab, und der Gewinn der Firma sinkt. Kurz: Diese „Marginalitäten“ sind es, die Werte, Nutzen, Kosten, Entschädigungen, Gewinne in der Marktwirtschaft erklären. Es sind fließende, nicht feste Werte.
Alle Beteiligten am Markt, am Tausch, rechnen. Sie bedenken ihren eigenen Nutzen dabei, müssen aber, damit die Gegenseite einhängt, auch deren Nutzen zugestehen. Nur Gewalt, auch ökonomische Gewalt in Form von Monopolen oder Kartellen, kann dies verzerren – weshalb diese verboten und verfolgt werden (obwohl der Staat selbst oft die schädlichsten Monopole schafft oder unterstützt). Oder wenn der Staat mit seiner Überdosis an Regeln die Märkte verzerrt, dann eben dringt der Markt durch alle Ritzen, bis hin zur Korruption, also zu „geldwerten Leistungen“ für das Erkaufen der Möglichkeit, die staatlich errichteten Hindernisse für den freien Tausch zu umgehen…
Der Markt schafft Unterschiede und keine Gleichheit – zum Vorteil aller
Das Ergebnis von Marktbeziehungen ist „Gefälle“, manche sind erfolgreich, manche nicht. Bedingung dabei ist nur, dass alle Marktpositionen bestreitbar sind – wer große Gewinne macht, wer ein Superprogramm auf IT erfand, muss stets Konkurrenz gewärtigen. Noch klarer gesagt, gegen Verharmloser und Kritiker aller Art: Märkte schaffen Unterschiede, nicht Gleichheit. Sonst wüssten die Teilnehmer ja nie, was erfolgreicher, produktiver, nützlicher ist. Adam Smiths „unsichtbare Hand“ hat dann ihre Lenkungsrolle. Und der Plural „Märkte“ ist ebenfalls wichtig – die Marktwirtschaft besteht aus Tausenden von Märkten.
Gnadenlos wird Marktteilnehmern oft pures Eigeninteresse unterstellt. und ihr Verhalten deshalb als das eines „homo oeconomicus“ kritisiert. Doch seit über siebzig Jahren nuanciert die Wirtschaftslehre das „Ökonomische“ dieser Menschen mit dem Taschenrechner im Kopf. Gemäß Verhaltensökonomie und Spieltheorie, vielfach nobelpreisgekrönt, sind auch die Motive der Tauschenden nicht linear oder stur. Sondern sie fürchten Verluste mehr, als sie Gewinne schätzen, sie führen „Buchhaltung“ und trennen sich von einem Gut, einer Aktie nicht, auch wenn der Markt wegbricht, sie sind nicht alle gleich gut informiert, sie folgen Herdenverhalten. Oder Anomalien treten auf, etwa, dass ein Luxus-Gut umso eher gekauft wird, je teurer es ist – auch wenn es deshalb gar keinen größeren Nutzen bringt.
Die beste Regulierung: Disziplinierung durch den Markt
Von solchem individuellem Verhalten auf gesamtwirtschaftliche Trends zu schließen, ist schwierig und umstritten. Anhänger des Ökonomen der Zwischenkriegszeit John M. Keynes glauben, große Aggregate handhaben zu können – sparen, investieren, konsumieren, exportieren, alles steuerbar mit mehr oder weniger Geldmenge, höheren oder tieferen Zinsen, mit Anstoßen der Nachfrage aus dem Staatsbudget. Diese Kolumne bezweifelt die Bonität dieser Rezepte seit je und weist mit Nachdruck auf das Scheitern einer solchen Politik und deren Folgen hin: unkontrolliert wachsende Staatsschulden, Geldschwemme zwecks Aufkaufen dieser Schulden, damit verbundene Fehlleitungen aller Art bis hin zu einer äußerst unsozialen Vermögenskonzentration. Die österreichische Schule der Ökonomie hingegen stellt das erwähnte individuelle Verhalten der Marktakteure in Rechnung, betont wie wichtig das Güterangebot und seine stete Ausweitung, nicht die ewig gepuschte Nachfrage ist, sowie gute und vor allem weniger Arbeitsmarktregeln und freie Bahn für innovative Firmen, ungebremst durch Regeln oder Gewinnabschöpfungen, aber im Falle des Scheiterns durch das Zulassen von Krisen bis hin zu Konkursen sanktioniert und diszipliniert („schöpferische Zerstörung“).
Über das volkswirtschaftliche Geschehen gibt die Statistik Auskunft, oder auf Firmenebene die Bilanz. Viele Kommentatoren vernachlässigen solche Fakten. Solche beenden aber oft das viele Werweißen und Behaupten… Für Laien lesbar gemacht sind sie beispielsweise, und humorvoll, durch Walter Krämer („So lügt man mit Statistik“, oder „Statistik verstehen“).
Denken statt Fabulieren, Sachargumente statt moralisch aufgeheizte Debatten
Wie solche Fakten im Kopfe sortiert werden und zu Erkenntnis führen, hat Nobelpreisträger Daniel Kahnemann gezeigt. In einem ersten Aufwallen sieht man Fakten mit Emotion, spontan („System 1), dann aber presst man diese Fakten durch das Gitter bisheriger Erfahrungen, des Wissens, der Vergleiche („System 2“). Jeder, der über Volkswirtschaft redet, kann sich so prüfen, ob er fabuliert oder schon nachdenkt… Über endlose Diskussionen mit Beispielen gibt schließlich der Philosoph Karl Popper das Urteil: Sobald einer Reihe von Beispielen oder gar einer Theorie ein einziger Fakt entgegensteht, sind sie falsch und müssen weiter entwickelt werden.
Dazu noch eine methodische Bemerkung zu hochgradig mit Moral geladenen Diskussionen in Ökonomie oder Sozialpolitik: alle sollen zugeben, dass sie von den gleichen ethischen Standards ausgehen, jene die mehr Umverteilung und jene die sie verringern wollen. Statt den Andersdenkenden gleich als unmoralisch zu verdächtigen, würde dies die sachliche Auseinandersetzung über die Angemessenheit der verschiedenen Konzepte fördern.
Das Geld ist das „allgemeine Dritte“ im Tausch zwischen den Gütern und Diensten. Früher hatte es eigenen, materiellen Wert (Gold, Silber) – d.h. es war selbst ein ökonomisches Gut, das anderen Sachwerten und den Produkten menschlicher Arbeit entsprach –, seit hundert Jahren fabrizieren es die Notenbanken und die Geschäftsbanken „aus dem Nichts“ (FIAT-money = Geld per Dekret, ungedecktes Papiergeld). Ohne disziplinierte Geldschöpfung aber tauchen alle die von Kritikern verwünschten Spekulationen auf: Kursblasen, Kreditpyramiden – öffentliche und private – und am Ende wird Voltaire einmal mehr Recht behalten: „Papiergeld kehrt immer zu seinem inneren Wert zurück, zu Null“.
Null-Summen-Denken, „Robinsonaden“ und andere Fehlschlüsse
Vor gewissen pseudo-ökonomischen Ansichten muss man weit wegrennen. Da wäre das Null-Summen-Denken: viele meinen, wenn der eine gewinnt, verliert notwendigerweise ein anderer. Steigen Gewinne, leidet der Arbeitende. Steigt der Lohnanteil in der Wirtschaft, sind die Firmen ruiniert. Gewinnt einer an der Börse, plündert er andere. Arbeitet einer länger, oder in Überzeit, nimmt er einem andern die Arbeit weg – falsch (wie ist es denn mit den Frauen, die arbeiten – nehmen diese den Männern etwa die Arbeit weg…?) Doch auch hier sind die Verläufe nicht-linear, sondern dynamisch – Werte werden geschaffen, vermehrt: Wertschöpfung (hoffen wir’s).
Oder wenn manche die volkswirtschaftlichen Vorgänge mit Natur und Biologie erklären: „der Geldkreislauf ist wie der Blutkreislauf“, oder „die Bäume wachsen nicht in den Himmel“. Mag sein, aber bleiben wir bei Statistik und gesellschaftlichen Abläufen, die immer ein Geflecht menschlicher Handlungen sind.
Ganz grob verletzt werden gesellschaftliche Aspekte bei „Robinsonaden“ – man veranschaulicht, wie Robinson in ein Fischernetz investierte, wie er seinen Gefährten Freitag zum Arbeiten anhielt. Unsinn, auch wenn dieses von Böhm-Bawerk stammende Gedankenexperiment hilfreich ist, um grundlegende ökonomische Zusammenhänge zu analysieren, aber damit kann man keine Volkswirtschaft verstehen, denn das war eine Insel, da waren keine Märkte, keine Tauschakte, keine Gesellschaft.
Etwas Mut braucht es heute, die modische neurophysikalischen Experimente abzulehnen. Da werden Studenten vorgeführt, indem sie Geld gewinnen, verlieren, teilen sollen – und mit Elektroden am Kopfe soll geklärt werden, wo die Furcht, die Gier, der Altruismus sitzt. Totaler Mumpitz, schreibt sehr gut Felix Hasler („Neuromythologie“). Auch hier sind die Schlüsse solcher Professoren allzu kühn, von unterstelltem individuellem Verhalten bis zur Gesamtwirtschaft. Gesellschaft ist mehr als ein paar Studenten, die oft sogar immer wieder dieselben sind, in künstlicher Umgebung Fragebogen ausfüllen und Hirnströme ablassen…
Ein froher Ausblick aber – Markt und Eigentum sind zwei Organisationsformen der Gesellschaft. Markt muss sein, aber das Eigentum kann privat („kapitalistisch“) sein, oder genossenschaftlich, oder als Partner-Firma wie John Lewis in England mit 80’000 „Partnern“, denen die Firma gehört. Bedingung also – sie alle müssen tauschen, sie müssen der Marktgegenseite die Wünsche von den Augen ablesen. Nur so funktioniert es, nur so sind die Wünsche allseits gut aufgehoben, der Wohlstand optimal, ohne Obrigkeit, die es zum Schaden der Allgemeinheit immer besser zu wissen glaubt.
Teilen auf