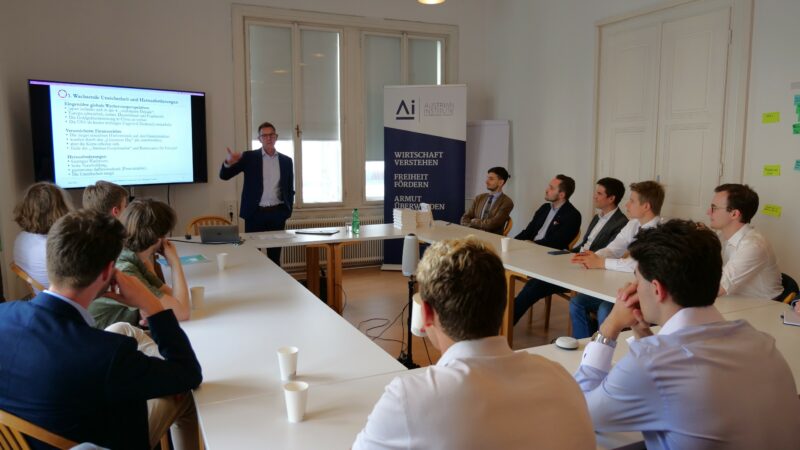Alternative Energie aus Wind und Sonne im Dienste von Wachstum und Wohlstand sind ein Versprechen, das nur sehr langfristig wird eingelöst werden können. (Bild: Cornell Frühauf/Pixabay).
Alternative Energie aus Wind und Sonne im Dienste von Wachstum und Wohlstand sind ein Versprechen, das nur sehr langfristig wird eingelöst werden können. (Bild: Cornell Frühauf/Pixabay). Mit der Klimapolitik verbinden sich zuweilen Hoffnungen auf eine doppelte Dividende. Neben dem langfristigen Klimaeffekt versprechen manche Protagonisten zusätzlich einen Wachstumsschub in der Gegenwart. Denn, so die Begründung, die Dekarbonisierung der Wirtschaft erfordere massive Investitionen, die die Wirtschaft ankurbeln würden. Wahr ist jedoch: Klimapolitik wirkt – wenn überhaupt – nur in sehr langer Frist positiv auf das Klima und erst damit auch auf Wachstum und Wohlstand. In der Zwischenzeit kostet sie Konsummöglichkeiten und belastet tendenziell das Wirtschaftswachstum. Die Energiewende fällt zudem in eine Phase, in der demografisch bedingt die Wachstumskräfte nachlassen. Umso mehr kommt es darauf an, klimapolitisch auf marktwirtschaftliche Instrumente zu setzen, um die hohen Kosten möglich niedrig zu halten. Gleichzeitig wird die klassische Wachstumspolitik wichtiger, auch weil sie Verteilungskonflikte entschärft. Wunder lassen sich so aber nicht bewirken – die Politik muss sich daher darauf einstellen, immer weniger aus dem Vollen schöpfen zu können und stattdessen klare Prioritäten zu setzen.
Demografischer Wandel hinterlässt deutliche Bremsspuren im Wachstum
In den 2020er Jahren lastet der demografische Wandel von Jahr zu Jahr stärker auf den Wachstumskräften der deutschen Wirtschaft. Sichtbar wird das in den Schätzungen zur Entwicklung des Produktionspotenzials, das die Wirtschaftsleistung bei Normalauslastung der gesamtwirtschaftlichen Kapazitäten beschreibt. In den zurückliegenden Jahrzehnten bewegten sich die Potenzialwachstumsraten um 1,4 Prozent. Um so viel konnte die Wirtschaftsleistung Jahr für Jahr spannungsfrei zulegen.
Manche sehen in dem massiven Investitionsbedarf, den die Energiewende auslöst, einen neuen Wachstumsmotor. „Mehr Investitionen = mehr Wachstum“, so die Vorstellung. Das ist leider eine Illusion.
Diese Zeiten sind jetzt vorbei. Die alternde Bevölkerung drückt auf die Zahl der Erwerbspersonen, dementsprechend geht die Wachstumsrate des Produktionspotenzials in den Sinkflug über. Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute rechnen in ihrer jüngsten Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2026 nur noch mit 0,75 Prozent. Das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Gegen Ende des Jahrzehnts dürften wir bei unter 0,5 Prozent angekommen sein. Qualifizierte Zuwanderung und mehr Erwerbsbeteiligung können diese Trends etwas mildern, ein Game Changer wird daraus aber nicht mehr.
Neue Knappheiten durch Klimaneutralität
Dekarbonisierung ist das zweite Megathema der 2020er Jahre (und darüber hinaus). Wenn die Produktion emissionsneutral werden soll, dann ist das vom Ressourceneinsatz her ein extrem ambitioniertes Vorhaben. Der Grundgedanke ist hingegen alles andere als spektakulär. Denn es geht im Wesentlichen darum, eine knapp gewordene Ressource – die Absorptionsfähigkeit der Atmosphäre für Treibhausgase – in das ökonomische Kalkül einzubeziehen. Das ist ökonomisches Alltagsgeschäft. Hierzu braucht es einen Mechanismus, der Unternehmen und Konsumenten erlaubt, mit dieser neuen Knappheit so umzugehen, dass das Ziel der Dekarbonisierung zu möglichst geringen Kosten gelingt (was nicht ausschließt, dass die Kosten trotzdem hoch sind).
Ein solcher Mechanismus muss nicht erst erfunden werden, wir kennen ihn längst, nämlich Marktpreise für das, was knapp ist: Die Emission von Treibhausgasen braucht ein Preisschild. Emissionsrechte lassen sich an Börsen handeln, wo sich entsprechende Preise bilden. Wenn wir auf diese marktwirtschaftliche Lösung verzichten und stattdessen in interventionistischer Manier minutiös vorgeben, mit welchen Technologien das erreicht werden soll und in welchem Sektor das in welchem Jahr bis wann zu geschehen hat, dann machen wir das Ganze sehr bürokratisch, sehr teuer, und zwar wesentlich teurer als nötig. Teuer wird es auf absehbare Zeit allemal, weil wir auf eine leicht zu erschließende Energiequelle mit Blick auf deren befürchtete Langzeitfolgen verzichten.
Umbau statt Aufbau des Kapitalstocks
Manche sehen in dem massiven Investitionsbedarf, den die Energiewende auslöst, einen neuen Wachstumsmotor. „Mehr Investitionen = mehr Wachstum“, so die Vorstellung. Das ist leider eine Illusion. Dekarbonisierung bedeutet einen tiefgreifenden Umbau des Kapitalstocks. Dafür brauchen wir erhebliche Investitionen, richtig. Aber diese Investitionen unterscheiden sich von dem, was wir gewohnt sind, dadurch, dass mit ihnen der Kapitalstock eben „nur“ umgebaut und nicht weiter aufgebaut wird. Ein Großteil der Investitionen in die Energiewende wird nicht die Produktionskapazität auf absehbare Zeit erweitern, sondern sie klimaneutral machen. Das bedeutet am Ende des Tages: Wir produzieren noch genauso viel Energie wie vorher, genauso viel Autos wie vorher, genauso viele chemische Produkte wie vorher, aber mit weniger CO2-Emissionen. Unsere Wirtschaftsleistung steigt dadurch auf absehbare Zeit nicht.
Eine volkswirtschaftliche Rendite kann dieses Unterfangen erst in sehr langfristiger Perspektive abwerfen, sofern alles so eintritt, wie man es sich vorstellt und insbesondere die übrige Welt mitspielt. Im Erfolgsfalle findet dann die nächste Generation klimatisch günstigere Produktionsbedingungen vor, als man es sonst erwarten würde. Bis es so weit ist, dürfte es 20 bis 30 Jahre dauern. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass wir durch diese Investitionen in den nächsten zehn bis zwanzig Jahren trotz erheblicher Investitionstätigkeit unsere Produktionskapazitäten nicht ausweiten. Und deshalb darf man sich nicht der Illusion hergeben, im Zuge der massiven Investitionen würde die Wirtschaft auf absehbare Zeit stärker wachsen.
Wir machen bislang funktionsfähige Technik obsolet und müssen dafür neue Techniken entwickeln, um am Ende die gleichen Produkte zu produzieren. Und damit ist das Ganze auf absehbare Zeit keine Wachstumsstory.
Einzelne Branchen würden natürlich schon wachsen: Diejenigen Unternehmen nämlich, die bei der Entwicklung und Umsetzung neuer Verfahren beteiligt sind. Aber gesamtwirtschaftlich kommt es nicht zu einem zusätzlichen Wachstum, weil wir an anderer Stelle Kapazitäten vorzeitig stilllegen (Kohlekraftwerke, Atommeiler) oder aufwendig umrüsten müssen (Stahl- oder Chemieproduktion). Zum ausrangierten Kapitalstock gehört auch, dass wir bestimmtes Wissen nicht weiter nutzen (z. B. zum Bau von Verbrennungsmotoren). All das kostet für sich genommen Wachstum. Man muss also beides zusammen sehen: Wir machen bislang funktionsfähige Technik obsolet und müssen dafür neue Techniken entwickeln, um am Ende die gleichen Produkte zu produzieren. Und damit ist das Ganze auf absehbare Zeit keine Wachstumsstory.
Kein neues „Wirtschaftswunder“
War nicht aber das „Wirtschaftswunder“ nach dem Krieg auch mit hohen Wachstumsraten verbunden? Könnte man nicht den Vergleich wagen, dass das vorzeitige Abschalten bestehender Kapazitäten so ähnlich wirkt wie die Kriegszerstörung, nur eben ohne Krieg, sondern – ganz im Gegenteil – für einen guten Zweck? Dürfen wir deshalb vielleicht doch auf einen kräftigen Wiederaufbau-Aufschwung hoffen? Das ist eine schöne Vorstellung, unterliegt aber leider einem Denkfehler.
Denn ohne Krieg (und der unproduktiven Aufrüstung in den Vorkriegsjahren) hätten wir den Kapitalstock in dieser Zeit weiter ausgebaut, statt ihn zu zerstören. Dann hätten wir zwar ab den 1950er Jahren keine so hohen Wachstumsraten gesehen, dies aber nur deshalb, weil wir zuvor mit dem Produktionspotenzial nicht so tief abgestürzt wären. So musste sich die Nachkriegswirtschaft von einem niedrigen Niveau wieder hochrappeln – das äußert sich in hohen Wachstumsraten, aber einem insgesamt massiv herabgesetzten Wohlstandsniveau.
Gäbe es mit der Energiewende zugleich eine Wachstumsdividende zu verdienen, hätten wir kein globales Koordinationsproblem in der Klimapolitik.
Ohne Krieg hätten wir also auch beim Pro-Kopf-Einkommen deutlich besser dagestanden, wie man etwa an der Schweiz sehen kann, wo der Kapitalstock während der Weltkriege nicht geschliffen wurde. Deshalb kann man die damalige mit der heutigen Situation nicht vergleichen. Vergleichbar wäre es nur, wenn wir sofort alle Kohle-, Gas- und Atomkraftwerke abstellen und auch Rohölimporte stoppen würden. In diesem Szenario würde die Wirtschaftsleistung infolge der dann abrupt eintretenden Energiekrise dramatisch einbrechen. Von diesem massiv geschmälerten Niveau könnten wir uns dann tatsächlich mit kräftigen Wachstumsraten nach und nach herausarbeiten. Aber eben nur, weil man das Niveau zunächst in den Keller geknüppelt hat. So ein „Wachstumsprogramm“ sollten wir uns besser nicht wünschen.
Konsumverzicht unvermeidbar
Ohne nennenswerte Wachstumseffekte bedeutet der zusätzliche Investitionsbedarf für die Energiewende, dass die Wirtschaftsleistung in den 2020ern und 2030ern nur noch zu einem kleineren Teil für Konsumzwecke verwendet werden kann (im Vergleich zu einem Szenario ohne Dekarbonisierung). Diejenigen, die sich ehrlich machen bei der Klimapolitik, sagen daher auch klar, dass die Energiewende mit einem Konsumverzicht in der Gegenwart einhergehen muss. Dieser notwendigen Verzicht macht es ja so schwierig, auch die übrige Welt ins Boot zu holen.
Insbesondere fällt den weniger entwickelten Ländern diese Einschränkung noch schwerer als den hochentwickelten Industrieländern. Gäbe es mit der Energiewende zugleich eine Wachstumsdividende zu verdienen, hätten wir kein globales Koordinationsproblem in der Klimapolitik. Der Verzicht auf fossile Energieträger, die für den Menschen leicht verfügbar sind, erfordert einen weltweiten Konsumverzicht in der Gegenwart und das für viele Jahre.
Abschmelzen der Leistungsbilanzüberschüsse greift zu kurz
Am notwendigen Konsumverzicht führen auch die deutschen Leistungsbilanzüberschüsse nicht vorbei. Wer meint, die Deutschen könnten ihre Energiewende stemmen, indem sie die Exportüberschüsse abschmelzen, um nicht auf Konsum verzichten zu müssen, verkennt die globale Dimension des Problems. Rein national gedacht mag das zwar stimmen, bedeutet dann allerdings zweierlei. Zum einen verschieben wir damit die Lasten auf die nächste Generation, die dann ein geringeres Auslandsvermögen erbt. Im Ergebnis muss sich die zukünftige Generation im Konsum einschränken und nicht schon die derzeitige. Das passt nicht zum Narrativ der Klimapolitik, wonach die heutige Generation die Ressourcen zu Lasten der Nachkommen überstrapaziert. Darüber mag man noch geteilter Meinung sein, denn die nächste Generation hat ja keinen natürlichen Anspruch auf ein bestimmtes Auslandsvermögen.
Wenn die Klimapolitik überhaupt erfolgreich sein soll, dann nur, wenn sie ein weltweites Unterfangen wird. Das heißt, die übrige Welt muss natürlich ihrerseits massiv in erneuerbare Energien investieren.
Wichtiger ist daher die Tatsache, dass diese Überlegung weltwirtschaftlich nicht aufgeht. Denn wenn die Klimapolitik überhaupt erfolgreich sein soll – und darüber besteht Konsens, weil es eine Frage der Logik ist –, dann nur, wenn sie ein weltweites Unterfangen wird. Das heißt, die übrige Welt muss natürlich ihrerseits massiv in erneuerbare Energien investieren. In einer Welt, in der alle verzichten müssen, wird es schwer fallen, Auslandsvermögen zu nutzen und damit die anderen Länder zusätzlich zu belasten. Deshalb kann man sich keinen schlanken Fuß machen, indem die Deutschen einfach ihre Leistungsbilanzüberschüsse runterfahren.
Klassische Wachstumspolitik weiterhin gefragt
Nimmt man Demografie und Dekarbonisierung zusammen, so verstärken beide Megatrends in den 2020er Jahren und darüber hinaus die Verteilungskonflikte. Der Kuchen wächst schwächer, gleichzeitig steigen die Ansprüche – sowohl für die Versorgung der Älteren als auch für den Umbau des Kapitalstocks. Das stellt hohe Ansprüche an die Wirtschaftspolitik. Es kommt jetzt in besonderem Maße darauf an, die Produktivität zu stärken, um aus dem, was man hat, das Beste zu machen. Das ist klassische Wachstumspolitik. Zudem muss die Energiewende außenwirtschaftlich eingebettet sein, andernfalls führt sie nur zu einer Deindustrialisierung hierzulande. Das wäre kein Beispiel, dem irgendjemand auf der Welt freiwillig folgen würde.
Mehr denn je kommt es daher in der Wirtschaftspolitik auf vorbildliche Ordnungspolitik an. Diese entlastet auch den bürokratischen Apparat. Die Aufgabe ist komplex genug. Es gilt daher, sich die Kräfte gut einzuteilen und sie nicht damit zu vergeuden, jeden Einzelfall regulieren zu wollen, sondern die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen.
Mühsame Deregulierung, kein Schalter für den Produktivitätsturbo
Wachstumspolitik ist immer langfristig angelegt. Das erfordert Geduld und einen langen Atem. Kurzfristige Erfolge darf man nicht erwarten. Die sich abzeichnende Wachstumsschwäche lässt sich nicht dadurch abwenden, dass man mit ein paar Maßnahmen den Produktivitätsturbo zündet, um wieder aus dem vollen schöpfen zu können. So funktioniert es leider nicht.
Beispiel Bildungspolitik: Es kommt für das Wirtschaftswachstum nicht nur auf die Anzahl der Köpfe an, sondern vor allem auch darauf, was in den Köpfen ist – und damit auf das Bildungssystem. Selbst wenn wir dort heute zu tiefgreifenden Verbesserungen kommen, wird sich das frühestens in zehn Jahren bei der Produktivitätsentwicklung zeigen. Das ist also ein sehr langfristiger Effekt, den man da im Auge hat. Das spricht nicht dagegen, heute die Weichen zu stellen, aber es widerspricht dem Glauben, wir müssten die Wachstumsschwäche der 2020er Jahre nicht so ernst nehmen, weil noch viele Reserven für einen abrupten Produktivitätsanstieg brachlägen.
Politiker müssen einsehen, dass sie gegenüber den unternehmerischen Akteuren keinen Wissensvorsprung haben. Im Gegenteil: Durch seinen systematischen Wissensnachteil macht sich der Staat zur Beute von Partikularinteressen.
Natürlich gibt es auch Dinge, die schneller wirken, wenn sie denn umgesetzt würden. Etwa die Entbürokratisierung und die Digitalisierung des Staatssektors. Es hat aber Gründe, weshalb uns das auch in der Vergangenheit nicht in dem Maße gelungen ist, wie es seit vielen Jahren von allen Regierungen gleich welcher Couleur versprochen wurde. Deregulierung bedeutet immer auch, dass sich die Politik an vielen Stellen wieder zurücknehmen muss. Das erfordert einen Mentalitätswechsel, der nicht über Nacht kommt. Es gilt wegzukommen von der Vorstellung, jeden Einzelfall penibel regeln zu wollen, was einen Wust an Vorschriften schafft, der am Ende die ökonomische Aktivität lähmt.
Politiker müssen einsehen, dass sie gegenüber den unternehmerischen Akteuren keinen Wissensvorsprung haben. Im Gegenteil: Durch seinen systematischen Wissensnachteil macht sich der Staat zur Beute von Partikularinteressen, je stärker sich die Politik auf die schiefe Ebene des Mikromanagements einlässt. Nicht zuletzt beschneiden marktwirtschaftliche Reformen auch Bürokratenkarrieren, was interne Widerstände provoziert und die Deregulierung verzögert.
Auf die Idee, bürokratische Hemmnisse abzubauen, sind nicht erst die jetzigen Koalitionäre gekommen. Das findet sich so oder ähnlich in jedem Koalitionsvertrag der vergangenen Jahrzehnte. Die eigentliche Schwierigkeit liegt darin, die hehren Ziele wahr werden zu lassen. Die Absichtsbekundungen sind wohlfeil und trotzdem richtig, aber es tatsächlich umzusetzen, ist eben noch eine ganz andere Sache. Und zwar nicht nur für den Windkraftausbau, sondern generell für die ökonomische Aktivität. Denn je produktiver die Gesamtwirtschaft, desto eher sind die massiven Herausforderungen von Demografie und Dekarbonisierung zu stemmen.
Dieser Essay gründet auf dem BTO Podcast zu den „Megatrends für Deutschlands Zukunft“, den der Autor mit Daniel Stelter im Dezember 2021 geführt hat. Das vollständige Gespräch finden Sie hier.
Teilen auf