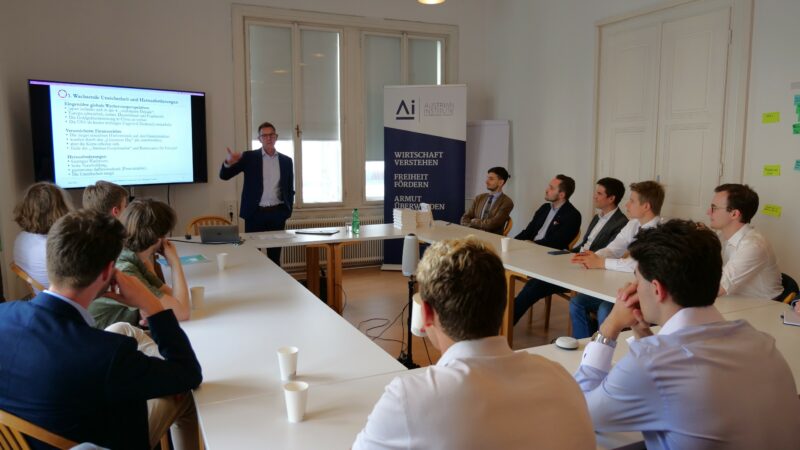Soziale Ungleichheit ist an vielen Orten offensichtlich. Dort wo sie kein existenzielles Problem mehr ist, wird sie aber oft am stärksten wahrgenommen – eine Folge der durch den Wohlfahrtsstaat erzeugten Anspruchsmentalität? (Bild: fotolia/gustavo)
Soziale Ungleichheit ist an vielen Orten offensichtlich. Dort wo sie kein existenzielles Problem mehr ist, wird sie aber oft am stärksten wahrgenommen – eine Folge der durch den Wohlfahrtsstaat erzeugten Anspruchsmentalität? (Bild: fotolia/gustavo) Friedrich von Hayeks berühmte These, der freie Markt sei die größte Entdeckung in der Geschichte der Menschheit, lässt eigentlich jeden kalt. Hier gibt es also einen akuten Gefühlsbedarf, die Notwendigkeit einer emotionalen Gestaltung der modernen Gesellschaft. Das leisten die Massenmedien, indem sie ständig soziale Ungleichheiten zeigen. So bedienen sie die rousseauistische Nostalgie nach einer von archaischen Gefühlen geleiteten Gesellschaft, in der ein autoritärer Staat sichtbar „soziale Gerechtigkeit“ schafft.
Das Mysterium der sozialen Gerechtigkeit
„Wo Unterschiede fehlen, droht Gewalt.“ Dieser Satz des Kulturanthropologen René Girard müsste über dem Eingangstor zur modernen Massendemokratie stehen. Kultur ist immer Differenzierung, und Entdifferenzierung provoziert Gewalt. Denn nicht die Unterschiede, sondern ihre Auflösung erzeugen Rivalität. Und es ist eine bittere Ironie der Weltgeschichte, dass der moderne Demokratisierungsprozess die Macht der Rivalität nicht geschwächt, sondern gesteigert hat. Gerade der moderne Gleichheitsgrundsatz erzeugt Gewalt. Der Verlust der Unterschiede ruft allererst die Rivalität ins Leben, für die dann die Unterschiede verantwortlich gemacht werden. Das ist die Sprengladung des Begriffs „soziale Gerechtigkeit“.
Niemand kann den Begriff definieren, aber gerade deshalb funktioniert er so gut als Flagge des Gutmenschen, als Chiffre für die richtigen moralischen Gefühle. In dieser Frage erlaubt sich unsere restlos aufgeklärte Gesellschaft eine letzte große Mystifikation, den Appell an ein unkommunizierbares Gefühl. Soziale Gerechtigkeit ersetzt das Heilige.
Mehr Gleichheit durch Umverteilung scheint deshalb die selbstverständlichste politische Forderung zu sein, und tagtäglich findet sie in den Massenmedien Resonanz. Bei der Wahrnehmung der Ungleichheit ist ja der Filter der Stände und Kasten weggefallen – jeder ist ein Mensch wie du und ich. Und das macht jede Ungleichheit tendenziell zum Skandal. Der soziale Vergleich erzeugt Neid und lässt die Erwartungen explodieren. Und in dieser Gleichheitssucht steckt die größte Gefahr der modernen Demokratie, nämlich die Verlockung, einer Ungleichheit in Freiheit die Gleichheit in der Knechtschaft vorzuziehen.
Historisch betrachtet kämpfen Freiheit und Gleichheit zunächst gemeinsam, aber sie trennen sich nach dem Sieg. Das heißt: nur solange die Gleichheit die Freiheit politisch benutzen kann, verbünden sich Gleichheit und Freiheit. Nur im Kampf gegen autokratische Machthaber stehen Freiheit und Gleichheit auf derselben Seite der Barrikade. Der Kult der siegreichen Gleichheit fordert dann aber rasch das Opfer der Freiheit.
Der Hass auf die Ungleichheit ist die demokratische Leidenschaft par excellence. Und je weniger Ungleichheiten es gibt, desto größer wird der Hass auf sie. Das Prinzip Gleichheit wirkt also paradox: Je mehr Gleichheit praktisch durchgesetzt wird, desto unerträglicher wird jede noch vorhandene Ungleichheit. Je größer die Gleichheit, desto unerbittlicher das Verlangen nach noch mehr Gleichheit. Die statistisch erwiesene Ungleichheit wird als Ungerechtigkeit interpretiert und dann als zentrales Beweismittel im ideologiekritischen Prozess gegen die bürgerliche Freiheit eingesetzt. Die Gleichheit vor dem Gesetz schließt aber nicht Ungleichheit aus, sondern Willkür.
Wir sind erwachsen, wenn wir gelernt haben, mit der Ungleichheit zu leben. Wir verwechseln dann nicht mehr Ungerechtigkeit mit Ungleichheit. Ungerecht ist nämlich nicht die Ungleichheit, sondern das, was motivierte Menschen am Aufstieg hindert. Um das einzusehen, braucht man keine Theorie der Gesellschaft, sondern nur gesunden Menschenverstand.
Der Paternalismus des vorsorgenden Sozialstaates
Zunehmend mischt sich der Staat auch in die geringfügigsten Angelegenheiten der Bürger ein. Er sorgt für die Gesundheit, die Arbeit, die Erziehung und Bildung seiner Bürger. Aber er sorgt auch für unsere geistige Gesundheit und flößt uns die korrekten Gefühle und Ideen ein. In den modernen Massendemokratien sind die Regierenden keine Tyrannen mehr, sondern Vormünder.
Wohlfahrtsstaatspolitik erzeugt Unmündigkeit, also jenen Geisteszustand, gegen den jede Aufklärung kämpft. Und so wie es des Mutes bedarf, um sich des eigenen Verstandes zu bedienen, so bedarf es des Stolzes, um das eigene Leben selbständig zu leben. Wie für das Mittelalter ist deshalb auch für den Wohlfahrtsstaat der persönliche Stolz die größte Sünde. Vater Staat will nämlich nicht, dass seine Kinder erwachsen werden. Der Paternalismus des vorsorgenden Sozialstaates wird den Menschen aber nicht nur aufgezwungen – sie begehren ihn, denn er entlastet sie von der Bürde der Freiheit. Die verwaltete Welt ist für viele eine Wunscherfüllung.
Die umfassend Betreuten brauchen gar keinen freien Willen mehr und empfinden die totale Vorsorge als Wohltat. Der demokratische Despotismus entlastet – vom Ärger des Nachdenkens genau so wie von der Mühe des Lebens. Ein Netz präziser, kleiner Vorschriften liegt über der Existenz eines jeden und macht ihn auch in den einfachsten Angelegenheiten des Lebens abhängig vom vorsorgenden Sozialstaat. Die Betreuer verstehen sich als die guten Hirten einer fleißigen Herde. Und die wenigen Widerstrebenden werden nicht gezwungen, sondern entmutigt; sie werden nicht tyrannisiert, sondern zermürbt.
Der vorsorgende Sozialstaat operiert mit drei Kurzfehlschlüssen: Er schließt von Ungleichheit auf Benachteiligung, von Benachteiligung auf soziale Ursachen und von sozialen Ursachen auf paternalistische Maßnahmen. Damit übernimmt er die Gesamtverantwortung für die moderne Gesellschaft. Auch als er noch nicht so hieß, hat der vorsorgende Sozialstaat die neuen Untertanen gezüchtet – die betreuten Menschen. Sicherheit verdanken die meisten heute nicht mehr dem Gesetz, sondern der staatlichen Fürsorge. Im vorsorgenden Sozialstaat wird diese Daseinsfürsorge präventiv: Es wird geholfen, obwohl es noch gar keinen Bedarf gibt. Konkret funktioniert das so, dass die Betreuer den Fürsorgebedarf durch die Erfindung von Defiziten erzeugen. Der Wohlfahrtsstaat fördert also nicht die Bedürftigen sondern die Sozialarbeiter.
Soziale Gerechtigkeit als Umverteilung sorgt für die politische Stabilisierung der Unmündigkeit; sie bringt den Menschen bei, sich hilflos zu fühlen. Bei wohlfahrtsstaatlichen Leistungen muss man nämlich damit rechnen, dass der Versuch, den Opfern zu helfen, das Verhalten reproduziert, das solche Opfer produziert. Wer lange wohlfahrtsstaatliche Leistungen bezieht, läuft Gefahr, eine Wohlfahrtsstaatsmentalität zu entwickeln; von Kindesbeinen an gewöhnt man sich daran, von staatlicher Unterstützung abzuhängen. Und je länger man von wohlfahrtstaatlichen Leistungen abhängig ist, desto unfähiger wird man, für sich selbst zu sorgen.
Umverteilungspolitik reduziert also nicht die Armut, sondern die Kosten der Armut. Jede Transferleistung reduziert nämlich den Anreiz, die Armut durch eigene Produktivität zu überwinden. Mit anderen Worten: Die meisten politischen Hilfsprogramme ermutigen eine Lebensführung, die zur Armut führt. Die Massenmedien besorgen dann den Rest: Man lernt, sich hilflos zu fühlen, wenn man andere beobachtet, die unkontrollierbaren Ereignissen ausgesetzt sind. Und so sehnt man sich nach dem schützenden Vater, der in der vaterlosen Gesellschaft natürlich nur noch der Staat sein kann.
Die totale Daseinsvorsorge nimmt den Selbständigen das Geld und den Betreuten die Würde. Was die Würde des Menschen also wirklich antastet, ist gerade die Wohltat des Staates, die ihn abhängig macht. So produziert die Politik des Wohlfahrtsstaates, also typisch Umverteilung und Reichensteuer, paradoxe Effekte. Die Wohlfahrtsempfänger verlieren ihre Würde, weil sie sich das, was sie bekommen, nicht verdienen können. Die Produktiven folgen der Logik des ökonomischen Darwinismus und werden noch produktiver, um tatsächlich die „starken Schultern“ zu entwickeln, auf denen die Lasten der „sozialen Gerechtigkeit“ ruhen.
An die Stelle von Freiheit und Verantwortung treten Gleichheit und Fürsorge. Gegen die Abhängigkeit vom leistenden, gewährenden Staat bietet die Rechtsstaatlichkeit heute keinen rechten Schutz mehr. Deshalb droht uns ständig, durch Betreuung beherrscht zu werden – erst betreut, dann abhängig, dann gebeugt.
Satisficing
Wir müssen unterscheiden lernen zwischen der vernünftigen Forderung, dass jeder genug haben soll, und der utopischen Forderung, dass jeder gleich viel haben soll. Dass es einem schlechter geht als anderen, kann immer noch heißen, dass es einem gut genug geht. Wer dagegen auf Gleichheit fixiert ist, bemisst seine Lebenszufriedenheit nicht an dem, was ihm selbst zur Verfügung steht, sondern an dem, was anderen zur Verfügung steht. Die Sorge um die Gleichheit lenkt ihn ab von der Sorge um sich, also von der Frage, was wirklich wichtig ist.
Dieser Text entspricht dem Kurzreferat, das Norbert Bolz am „Forum Freiheit“ der Friedrich A. von Hayek Gesellschaft zum Thema „Wohlfahrtsstaat als Allmende. The Tragedy of the Commons” am 24. Oktober 2018 in Berlin gehalten hat. Hier können Sie den Beitrag auch direkt als Datei herunterladen. Mit freundlicher Genehmigung des Autors.