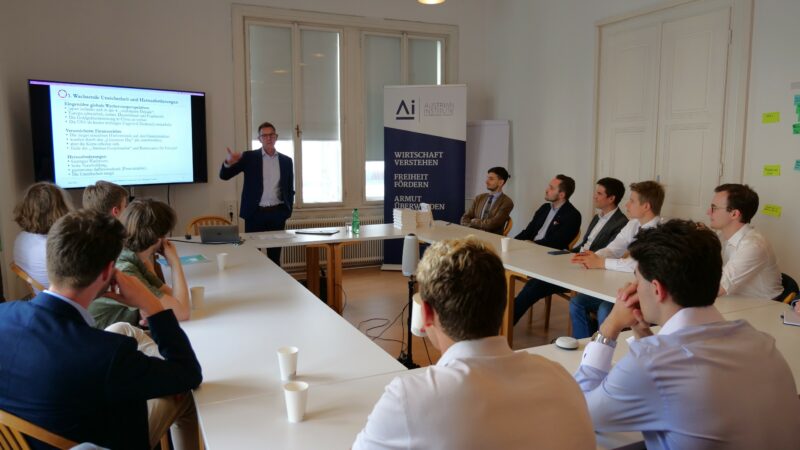Politiker reden gerne von Werten. Der Liberalismus stützt sich auf Prinzipien. Selbstbestimmung und – damit untrennbar verbunden – das Recht auf Privateigentum sind seine Fundamente. Heute verdanken wir dem Liberalismus mehr Freiheit und einen durch die freie Marktwirtschaft zustande gekommenen beispiellosen Wohlstand. Dennoch: Der Liberalismus ist in Verruf geraten, gerade bei Europas Eliten. Staatliche Regulierungen und marktfeindliche Interventionen nehmen überhand, und die Geldpolitik behindert zunehmend den Aufbau von Vermögen. So gerät die wirtschaftliche Freiheit immer mehr unter die Räder. Die Hauptursachen des Niedergangs sieht Thomas Mayer, ehemaliger Chefvolkswirt der Deutschen Bank, Gründungsdirektor des Flossbach von Storch Research Institute und Bestsellerautor, im Wohlfahrtsstaat und im „Dritten Weg“, einem seit den 1990er Jahren propagierten Kompromiss zwischen Kapitalismus und Sozialismus. Brillant zeichnet Mayer in seinem jüngsten Buch „Die Ordnung der Freiheit und ihre Feinde“ die Fehler der vergangenen Jahrzehnte nach und liefert am Ende ein „Programm zur liberalen Erneuerung“.
Ende der 1980er Jahre, so Mayer, kam die von John Maynard Keynes geprägte Idee der Globalsteuerung wieder in Mode. Nur sollte sie dieses Mal nicht über das „Deficit spending“ durchgeführt werden, das in den 1970er Jahren in explodierenden Staatsschulden, sinkendem Wirtschaftswachstum sowie steigender Inflation und Arbeitslosigkeit mündete. Nun sollte die Globalsteuerung über die Geldpolitik erfolgen. Auf diesem Weg wollte man mikroökonomische Flexibilität mit makroökonomischer Stabilität verknüpfen. Anstatt die Märkte zu dominieren sollte die „Steuerfunktion der Märkte durch die Politik ergänzt und verbessert, nicht aber behindert werden“, wie der englische Premier Tony Blair und der deutsche Kanzler Gerhard Schröder im Jahr 1999 in einem gemeinsamen Schreiben erläuterten. Wachstum wie im Kapitalismus und Absicherung wie im Sozialismus – das klang eigentlich wunderbar und ganz vernünftig, nur war es leider „zu schön, um wahr zu sein“, wie Mayer festhält.
Thomas Mayer: Die Ordnung der Freiheit und ihre Feinde. Vom Aufstand der Verlassenen gegen die Herrschaft der Eliten. FinanzBuch Verlag, München 2018 (www.finanzbuchverlag.de), 240 Seiten, ISBN: 978-3-95972-127-1, 17,99 €. Inhaltsverzeichnis – Leseprobe.
Bereits der Ansatz war falsch
Die Verwendung – oder besser gesagt der Missbrauch – der Geldpolitik für politische Zwecke widerspricht zunächst dem Recht auf Privateigentum. Geldeigentum ist eine „elementare Form für die Haltung von privatem Eigentum“. Daher greift der Staat durch Manipulation des Geldwerts zwecks Verfolgung eigener Ziele in die Eigentumsrechte seiner Bürger ein. Die gezielte Verringerung des Geldwerts zur Erreichung von Inflationszielen bezeichnet Thomas Mayer als „schleichende Enteignung“.
Darüber hinaus unterliegt der „Dritte Weg“ einem Irrtum über die Funktionsweise des freien Marktes. Makroökonomische Stabilisierung verändert auch „die Risikoeinschätzung auf mikroökonomischer Ebene“. Es ist ein innerer Widerspruch, einerseits die Steuerungsfunktion des Marktes zu nutzen, andererseits das Handeln der Wirtschaftsakteure durch staatliche Eingriffe – im konkreten Fall: die Geldpolitik – abzusichern, damit sie nicht mit den Konsequenzen ihrer Fehlentscheidungen konfrontiert sind: „Wirtschaftliches Handeln im Markt folgt einem Prozess von Versuch und Irrtum. Erfolg und Scheitern im Markt sind daher die zwei Seiten einer Medaille.“ Beim Dritten Weg muss nicht mehr der Einzelne Verantwortung für sein Handeln übernehmen. Die Lasten tragen Andere. Das hatte verheerende Folgen und veränderte die Struktur der Wirtschaft.
Ein aufgeblähter Finanzsektor gibt den Ton an
Wie Mayer aufzeigt, wurde durch die Geldpolitik der Finanzsektor künstlich aufgebläht und gibt heute „den Ton an, dem die Realwirtschaft folgt.“ Um die Konjunktur gegen Rezessionen abzusichern bekämpfen die Zentralbanken seit den späten 1980er Jahren jede Korrektur auf den Finanzmärkten mit niedrigeren Zinsen. „Drückt eine Planungsbehörde jedoch den Marktzins unter die Rate der Zeitpräferenz der Anleger, dann fragen die Investoren mehr Anlagekapital nach, als die Anleger an Ersparnissen anbieten.“ In den USA bildete sich eine riesige Kreditblase, die den Finanzsektor nährte. Als die Kreditblase in der Finanzkrise 2007/2008 platzte, folgte keine Trendumkehr. Im Gegenteil: Die Finanzdienstleistungen wuchsen weiterhin überproportional an und stellen ungebrochen den größten Sektor der US-Wirtschaft.
Die Zentralbanken haben genau jene Wirtschaftssektoren, die durch ihre Überschuldung die Finanzkrise ausgelöst oder verstärkt haben, zuerst gestützt und dann „wieder aufgepäppelt“, um eine tiefere Rezession zu vermeiden. Aus der Politik des billigen Geldes finden sie nicht mehr hinaus: Da sie „eine Aktienbaisse wegen der damit verbundenen Gefahr einer Rezession fürchten wie der Teufel das Weihwasser, werden sie die niedrigen Zinsen mit all ihren Kräften verteidigen.“ So werden die Finanzmärkte weiterhin „von der Droge des billigen Geldes der Zentralbanken beduselt“.
Der dritte Weg ist gescheitert
Der überdimensionierte Finanzsektor behindert heute das Wirtschaftswachstum, weshalb die Reallöhne und das reale Einkommen der Lohnempfänger weniger steigen. Doch das sind nicht die einzigen spürbaren Folgen: „Geldersparnisse werden nicht mehr verzinst. Die Fähigkeit der mittleren und unteren Einkommensschichten, durch Vermögensbildung für ihr Alter vorzusorgen, löst sich in Luft auf.“ Gleichzeitig steigen die Vermögenspreise, wovon besonders ältere und vermögende Menschen profitieren, während die jüngeren ohne Kapitelvermögen zurückbleiben. Der durch die Niedrigzinspolitik der EZB ausgelöste Anstieg der Vermögenspreise erzeugt aber nur „die Illusion eines Vermögensgewinns, der durch den Anstieg des produktiven Kapitalstocks nicht gedeckt ist.“ Willkommen in der „künstlichen Welt der Blasenökonomie“!
Der Staat als Manager von Klimawandel und Gesellschaft
Ein weiteres Kapitel widmet Meyer dem Wohlfahrtsstaat, der den Menschen jene Wärme und Geborgenheit verheißt, die sie in der liberalen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung zuweilen vermissen. In den vergangenen Jahrzehnten hat der Wohlfahrtsstaat seinen Aufgabenbereich erweitert. Er will „nicht nur sozial, sondern auch wirtschaftlich leistungsfähig und ökologisch ‚nachhaltig’ sein“. Doch die Kosten für die Energiewende sind enorm. Um die vom Weltklimarat geforderte Verringerung des CO2-Ausstoßes um mindestens 80 Prozent bis 2050 zu erreichen, müsste Deutschland geschätzte 1,5 bis 2,3 Billionen Euro investieren, umgerechnet 1,2 bis 1,8 Prozent des Bruttoinlandsprodukts pro Jahr, eventuell sogar mehr. Gleichzeitig sind die Prognosen über den bevorstehenden Klimawandel nach wie vor umstritten und die Modellsimulationen unsicher. Innerhalb der Wissenschaft bestehen divergierende Ansichten, weshalb es Thomas Mayer für gefährlich hält, dass „die Politik unumkehrbare Entscheidungen trifft, die sich auf eine der rivalisierenden Thesen stützt“. Hierzu müsste man freilich ergänzend anmerken, dass sich der Staat immerhin der Mehrheitsmeinung innerhalb der Wissenschaft angeschlossen hat, was Mayer aber nicht erwähnt. Der Volkswirt misstraut sichtlich den Modellrechnungen, weil aus seiner Sicht schlicht die Zeit fehlt, „um heute einen Bruch der Entwicklung über die letzten 10.000 bis 20.000 Jahre eindeutig feststellen zu können“.
Selbst wenn man aber alle offiziellen Schätzungen ernst nimmt, „kommt man auf kaum wahrnehmbare Auswirkungen der Erderwärmung auf die globale wirtschaftliche Entwicklung“, wie Mayer festhält. Gestützt auf eine Studie des Internationalen Währungsfonds würde sich das Wirtschaftswachstum in den ärmeren Ländern künftig um gerade einmal 0,1 Prozent pro Jahr vermindern. „Das ist von Jahr zu Jahr betrachtet so gering, dass es in den üblichen Unschärfebereich von Prognosen fallen würde.“ Würde man die betroffenen Länder jährlich für diese Einbußen entschädigen, wären die daraus entstehenden Kosten weit geringer, als die Kosten der Energiewende.
Besonders scharf kritisiert Mayer die Zunahme gesetzlicher Gebote. Statt der Freiheit des Einzelnen dort, wo die Freiheit des Anderen beginnt, durch Verbote Grenzen zu setzen, geben Gesetze nun vor, wie man zu handeln hat. Die Folge: Die Regierung wird zum „Manager der Gesellschaft“. Gut organisierte Gruppierungen beeinflussen die Regierung zu ihren Gunsten. Es entsteht „Klientelwirtschaft“. In den angelsächsischen und asiatischen Ländern wächst der „Crony Capitalism“ – das Zusammenspiel von mächtigen Wirtschaftskapitänen und Politik –, in Italien und Griechenland gibt es einen „aufgeblähten und ineffizienten Staatsapparat und versteckten Wirtschaftsprotektionismus zu Gunsten der Regierungsklienten“. In Deutschland wurde die liberale Demokratie durch den Korporatismus verformt, denn „spezifische Interessen relativ homogener gesellschaftlicher Gruppen lassen sich besser organisieren, als die breit gestreuten Interessen diversifizierter Gruppen.“ Die Dynamik der Gesellschaft nimmt somit in Summe ab.
Antiliberale Gegenkräfte und das chinesische Gegenmodell
Die ungezügelte Migration hat jüngst gemeinsam mit dem Scheitern des Dritten Weges und des Wohlfahrtsstaates das Vertrauen etlicher Bürger in die Elitennachhaltig zerstört. Politische Gegenkräfte sind im Aufwind, doch leider streben sie keine Wiederkehr des Liberalismus an: Linkspopulisten in Griechenland und Italien und rechte Kräfte wie der ungarische Premierminister Viktor Orbán machen gerade den Liberalismus für die Fehlentwicklungen verantwortlich. In einer Rede am 26. Juli 2014 interpretierte Orbán die Finanzkrise als Ende des Zeitalters des westlichen Liberalismus. Der liberale Staat könne nicht Ungarns gemeinsame Werte schützen. Die ungarische Nation müsse viel mehr als Gemeinschaft konstruiert werden. Orbán widerspricht „explizit dem Prinzip der freiheitlichen Organisation der Gesellschaft durch Regeln, die es dem Einzelnen erlauben, seine eigenen Ziele zu verfolgen“. Der Staat selbst solle viel mehr die Gesellschaft gestalten.
Die größte Herausforderung für Europa erblickt Thomas Mayer aber im chinesischen Gegenmodell, das seit dem Amtsantritt Xi Jinpings im Jahr 2013 von liberalen Vorstellungen konsequent abrückt. Chinas neues Modell bezeichnet Mayer als „staatsmonopolistischen Finanzkapitalismus“: „Staatliche Banken steuern die Wirtschaft durch die Vergabe von Krediten und sichern sich dadurch Einfluss auf die Industrie.“ Zur Durchsetzung seiner Ziele stützt sich der Staat auf modernste Technologien, mit deren Hilfe er die Menschen rund um die Uhr kontrolliert. Dieses Modell könnte trotz all seiner Fehler unserer „pervertierten liberalen Ordnung“ in Europa überlegen sein, fürchtet Mayer. An einer Rückkehr zur klassisch-liberalen Ordnungsidee führt also kein Weg vorbei.
Das Vier-Punkte-Programm
Vier zentrale Forderungen erhebt Thomas Mayer am Ende. An erster Stelle steht die Stärkung von Eigentumsrechten. Dafür brauche es „verteilungsneutrale Steuern und eine dem Bürger dienende Geldordnung.“ Eine Konkurrenz zwischen staatlich und privat emittiertem Geld hält Mayer für hilfreich. Neue digitale Währungen würden gute Voraussetzungen für eine künftige „multipolare Währungsordnung“ schaffen, in der sich das beste Geld durchsetzt. Und um den Euro zu reparieren könnte eine zu 100 Prozent mit Reservegeld der EZB gedeckte Euro-Bankeinlage geschaffen werden. Zu diesem Zweck müsste die EZB schlicht ihr Anleihenkaufprogramm fortsetzen und die „Rückzahlung auslaufender Staatskredite und Staatsanleihen übernehmen“. Die Umstellung von Kreditgeld auf gedecktes Geld könnte demnach „mit einer Verringerung der ausstehenden Staatsschuld verbunden werden“. Detaillierter ist Thomas Mayer auf dieses Thema in seinem im Jahr 2014 erschienen Buch „Die neue Ordnung des Geldes: Warum wir eine Geldreform brauchen“ eingegangen.
Zweitens fordert Mayer eine Rückkehr zu individueller Selbstbestimmung. Damit nicht mehr nur gut organisierte Gruppen durch ihren Einfluss auf die Politik staatliche Vorschriften zu ihren Gunsten durchsetzen, brauche es ein Ende positiver Verhaltensvorschriften, über die Regierungen die Menschen zu ihren selbst gesteckten Zielen hinsteuern. Auch Subventionen zur Beeinflussung wirtschaftlichen Handelns müssen auffordern. Sozialhilfe für jene, die ohne eigene Schuld in Not geraten sind, soll bleiben, nur ist das Motiv dabei „Nothilfe und nicht Umverteilung“.
An „Law and Order“ kommt auch der funktionierende liberale Staat nicht vorbei, wie der dritte Punkt zeigt: die Wiederherstellung von Vertrauen. Hierfür müssten innere und äußere Sicherheit gewährleistet werden – was natürlich auch etwas kostet. Spitz merkt Mayer an: „Der lenkende Wohlfahrtsstaat ist ohne Bedenken bereit, 1 bis 2 Prozent des deutschen Bruttoinlandsprodukts für das fragwürdige Projekt des Klimaschutzes auszugeben und zur Stützung der maroden Europäischen Währungsunion nicht mehr einzutreibende Kredite zu gewähren. Aber er schafft es nicht, die Ausgaben für seine Verteidigung auf das von ihm akzeptierte NATO-Ziel von 2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu heben“.
Viertens brauche es zur liberalen Erneuerung schließlich eine „Regierung unter dem Recht“. Das bedeutet auch ein Ende der „Expertokratie“ und eine „Wiederherstellung der Herrschaft des Parlaments über die Regierung“. Europaweit kann Mayer zufolge nur ein „konföderales Europa“ dies gewährleisten: Die staatliche Gewalt geht von den Völkern aus, eine „freiwillige vertiefte Zusammenarbeit verschiedener Gruppen von Völkern“ soll „in ausgewählten Bereichen möglich sein“.
Liberalismus statt Konstruktivismus
Lesenswert ist auch Thomas Mayers Nachzeichnung der geistesgeschichtlichen Wurzeln des Liberalismus zu Beginn seines Buchs. In dem römischen Senator Marcus Tullius Cicero sieht er den „wichtigsten Vordenker des späteren Liberalismus“, der schon früh die Vorteile des Pluralismus erkannte und den Vorzug Roms darin erblickte, dass „nicht das Talent eines Einzelnen, sondern vieler, die Verfassung begründete“. Die maßgeblichen Wegbereiter des modernen Liberalismus erblickt Mayer in John Locke, David Hume und Immanuel Kant. René Descartes, Thomas Hobbes und Jean-Jacques Rousseau sind für ihn hingegen Vertreter des „modernen Konstruktivismus“, die der „organisierten Gesellschaft“ in Form des Absolutismus und später des Sozialismus den Boden bereitet haben.
Thomas Mayers knappe Ausführungen zu diesen komplexen geistesgeschichtlichen Prozess mögen ergänzungs- und da und dort auch präzisierungsbedürftig sein; erhellend sind sie auf jeden Fall, vor allem weil er auf den wichtigen Zusammenhang zwischen Erkenntnis- und Gesellschaftstheorie hinweist. Hume und Kant zufolge stützt sich Wissen auf Erfahrung und nicht (nur) auf „reines Denken“ wie bei Descartes. Deshalb entstammen auch die Regeln des gesellschaftlichen Umgangs nicht den gedanklichen Konstrukten einzelner Ideologen und Utopisten, sie wachsen viel mehr durch Versuch und Irrtum.
In Summe deckt das Buch ein weites Feld an wichtigen Themenkreisen ab. Eng begrenzt sind dafür die Grundprinzipien, auf die es sich auf jeder Seite stützt. Zu ihnen gehören Autonomie, Privateigentum, negativ verstandene Freiheit, negativ formulierte Gesetze, nicht-konstruktivistisches Staatsverständnis sowie Raum für Versuch und Irrtum. Einen wichtigen Bezugspunkt bildet darüber hinaus durchgehend das Denken Friedrich August von Hayeks. Thomas Mayer ist eine ebenso umfassende, wie schlüssig durchargumentierte Schrift gelungen, die gleichzeitig ein kraftvoller Appell zur Rückkehr zur liberalen Gesellschaftsordnung ist, deren Genialität darin besteht, „einen Mechanismus zur Koordination der Handlungen freier Menschen geschaffen zu haben.“