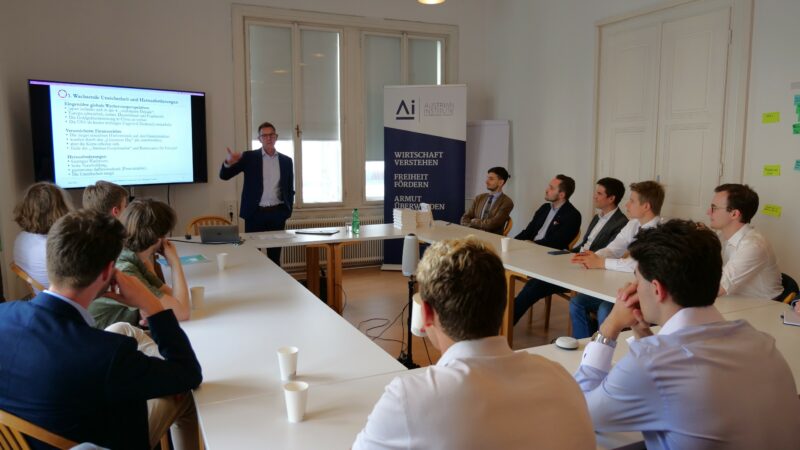Roboter in einer Autofabrik: Innovation, die marktfähige Produkte erzeugt, stammt aus der Kreativität der Unternehmen, den Ideen einzelner, aus Teamwork und der Bereitschaft von Investoren, mit ihrem eigenen Geld Risiken einzugehen. (Bild: Fotolia)
Roboter in einer Autofabrik: Innovation, die marktfähige Produkte erzeugt, stammt aus der Kreativität der Unternehmen, den Ideen einzelner, aus Teamwork und der Bereitschaft von Investoren, mit ihrem eigenen Geld Risiken einzugehen. (Bild: Fotolia) Die in den letzten Jahren von der Ökonomin Mariana Mazzucato verbreitete Ansicht, der Staat müsse vermehrt unternehmerisch tätig sein, denn von ihm stammten die wichtigsten Innovationen, ja er garantiere letztlich nachhaltige und nicht nur scheinbare Wertschöpfung, basiert auf historischen Irrtümern und einer ökonomischen Fehlanalyse. Darauf wies bereits Alberto Mingardi in einem ausführlichen Beitrag auf unserer Website hin, den wir auch als Austrian Institute Paper veröffentlicht haben. NZZ-Wirtschaftsredakteur Christoph Eisenring zeigt in seinem jüngsten Artikel in der Neuen Zürcher Zeitung (8. 12. 2020) ebenfalls entscheidende Denkfehler dieses Ansatzes auf. Wir veröffentlichen diesen Artikel nachfolgend mit freundlicher Genehmigung.
Kann man die Welt streng wissenschaftlich in „gut“ und „schlecht“ unterteilen? Natürlich nicht. Trotzdem hat sich die EU-Kommission einer solchen Übungsanlage verschrieben. Im Rahmen ihres „Green Deal“ lässt sie das „Universum wirtschaftlicher Aktivitäten“ von einem Expertenheer durchforsten und in nachhaltige und nichtnachhaltige Tätigkeiten unterteilen. Damit will sie Investoren erziehen, die „umweltbezogene und soziale Erwägungen“ nicht ausreichend berücksichtigen würden. Das hat in einen ersten, Hunderte von Seiten dicken Bericht gemündet.
Der EU-Kommission geht es letztlich darum, Investitionen in eine bestimmte Richtung zu lenken. Doch was „Nachhaltigkeit“ heißt, sollte nicht in Brüssel bestimmt werden.
Der Ökonom Clemens Fuest, Präsident des Münchner Ifo-Instituts, ist nicht dafür bekannt, Dinge aufzubauschen. Doch hierzu nimmt er kein Blatt vor den Mund: Diese Liste erinnere ihn an eine zentral geplante Wirtschaft, in der alle Bereiche fein säuberlich von der Planungsbehörde katalogisiert würden, sagte er unlängst an einem Vortrag.
Der EU-Kommission geht es letztlich darum, Investitionen in eine bestimmte Richtung zu lenken. Doch was „Nachhaltigkeit“ heißt, sollte nicht in Brüssel bestimmt werden. Wie sortiert man etwa die Kernenergie ein? Diese verursacht kaum Kohlendioxid, doch Länder wie Deutschland und die Schweiz wollen davon nichts mehr wissen.
Auch der Chef des Industriekonzerns Siemens, Joe Kaeser, kritisiert in der „NZZ am Sonntag“ die Kommission scharf: Selbst modernste Gasturbinen gälten in der EU nicht als umweltfreundlich, obwohl sie 60 Prozent weniger Emissionen verursachten als moderne Kohlekraftwerke. Mit ihrem Klassifizierungswahn bestimmt die EU-Kommission letztlich über das Wohl und Wehe von Firmen.
Der Staat kennt die Richtung nicht
Im Gespräch ist sogar, dass Banken Kredite mit weniger Eigenkapital unterlegen dürfen, wenn das Geld in „grüne“ Investitionen fließt. Die Erfahrungen aus der Finanzkrise sollten die Politiker eigentlich eines Besseren belehrt haben: Damals waren amerikanische Banken von der US-Regierung zur Vergabe von Hypotheken an arme Haushalte angehalten worden, was eine der Ursachen für die Subprime-Krise war.
Die Idee der staatlichen Lenkung ist nicht nur in der EU-Kommission en vogue. Eine Vertreterin dieser Bewegung ist die Ökonomin Mariana Mazzucato mit ihrem Buch „Das staatliche Kapital“. Darin wird behauptet, das iPhone, das Internet und viele andere Erfindungen beruhten auf staatlicher Forschung und Finanzierung. Aus diesem Grund solle der Staat eine viel aktivere Rolle einnehmen und „richtungsweisende Investitionen“ selbst anstoßen. Doch hier wird in Entwicklungen nachträglich eine Zwangsläufigkeit hineininterpretiert, die es so nie gegeben hat.
Vor fünfzig Jahren haben zum Beispiel Physiker unterschiedlicher Universitäten ihre Forschungspapiere im Auftrag des amerikanischen Verteidigungsministeriums über das sogenannte Arpanet geteilt. Heute gilt dieses Netz als eine Keimzelle des Internets. Aber wer hätte damals dessen Siegeszug auch nur im Entferntesten erahnt? Die staatliche, oft militärische Forschung kreiert zwar Spillovers, aber mit einer „missionsorientierten Innovation“ (Mazzucato) hat dies wenig zu tun. Ob etwas richtungsweisend war, weiß man immer erst ex post.
Dass man den Einfluss des Staates gerne überschätzt, zeigt auch der Blick in die Geschichte. Im 19. Jahrhundert sorgte die Eisenbahn für einen Produktivitätsschub. Dahinter steckte jedoch gerade nicht die öffentliche Hand, sondern privates Kapital. Dagegen behaupten die Befürworter staatlicher Innovationspolitik, private Eigentümer seien viel zu kurzsichtig und würden große Risiken scheuen. Doch dieser Vorwurf ist übertrieben, wie die Erfolge in der Entwicklung eines Impfstoffs gegen das Coronavirus nahelegen.
Pfizer will kein Staatsgeld
Die Brüder Sprüngmann sind durch den Verkauf ihrer Generika-Firma Hexal an Novartis reich geworden. Sie nahmen 2005 volle 150 Millionen Euro in die Hand, um über ein Jahrzehnt die Arbeit des Forscherpaars Özlem Türeci und Ugur Sahin zu finanzieren, die jetzt mit ihrer Firma Biontech Furore machen. Soeben wurde in England ihr Impfstoff zugelassen. Es ist dabei glückliche Fügung, dass dieselbe Methode, die die beiden für die Krebstherapie erforscht hatten, auch funktioniert, um das Coronavirus zu bekämpfen. Das Projekt für einen Impfstoff firmierte bei Biontech übrigens unter dem Namen „Lichtgeschwindigkeit“ – eine solche Bezeichnung kann man sich für ein staatliches Unterfangen nur schwer vorstellen.
Es braucht immer Menschen, die aus Forschungsergebnissen Produkte machen, die bei den Konsumenten auf Anklang stoßen.
Biontech hat vom deutschen Staat zwar Geld erhalten, aber da war das Unternehmen mit seiner Forschung längst ins Risiko gegangen. Sein Forschungspartner, der amerikanische Pharma-Gigant Pfizer, hat sogar ganz bewusst auf staatliche Unterstützung verzichtet. Als Grund führte der Pfizer-Chef Albert Bourla an, er habe seine Forscher von Bürokratie verschonen und verhindern wollen, dass sein Konzern im amerikanischen Wahlkampf (von Trump) instrumentalisiert wird.
Es brauchte somit den Wagemut eines reichen Brüderpaars, um einem begabten und initiativen Forscherpaar die nötige Zeit zu geben. Dessen Unternehmergeist wiederum zahlte sich aus, denn universitäre Spitzenforschung allein reicht nicht. Es braucht immer Menschen, die aus Forschungsergebnissen Produkte machen, die bei den Konsumenten auf Anklang stoßen. So wurde zum Beispiel auch der MP3-Player in Deutschland entwickelt, doch war es Apple, das die Technologie als Standard in seine iPods einbaute und so zu einem Welterfolg führte.
Unter Ökonomen gilt es als Gemeingut, dass mehr Geld für die Forschung gut angelegt ist. Doch das ist zu einfach. Laut einer Übersicht des amerikanischen Arbeitsministeriums ist die Rendite von Ausgaben für Forschung und Entwicklung zwar tatsächlich zweistellig – dies gilt aber nur für denjenigen Teil, der von Firmen getragen wird. Bei der öffentlich finanzierten Forschung konnte dagegen kein Effekt gefunden werden – das hatte zuvor auch der Industrieländerklub OECD rapportiert. Gut aufgestellt sind entsprechend Länder wie die Schweiz, Südkorea, Japan und auch zunehmend Deutschland, in denen nicht einfach viel geforscht wird, sondern dies auch noch vornehmlich in der Privatwirtschaft geschieht.
Dirigismus erstickt die Kreativität
Früher oder später wird in Diskussionen über die Rolle des Staates jeweils auf den „Sputnik-Moment“ verwiesen, also den Schock im Westen, als die Sowjetunion als erstes Land Satelliten ins All schickte. Die EU-Kommissions-Präsidentin Ursula von der Leyen bezeichnete wohl in Anspielung daran den Green Deal als Europas Mann-auf-dem-Mond-Moment. Die Sowjets hatten seinerzeit Unsummen in das Sputnik-Projekt gesteckt, wofür das Volk einen enormen Konsumverzicht leisten musste – gefragt wurde es nicht. Wer einem „innovativen Staat“ das Wort redet, sollte mit Vergleichen jedenfalls vorsichtig sein.
Es ist gerade nicht die Routine, sondern es braucht Entdeckergeist; es ist keine Expertenkommission, sondern es sind Erfinder und Unternehmer, die auf eigenes Risiko handeln, die den Fortschritt prägen.
Selbst in der Raumfahrt hat Gewohntes nicht ewig Bestand. Es entbehrt jedenfalls nicht der Ironie, dass mittlerweile die private Firma SpaceX des Tesla-Gründers Elon Musk sowohl amerikanische als auch russische Astronauten ins Weltall fliegt. SpaceX mit seinen wiederverwendbaren Raketen ist einfach günstiger und zuverlässiger als seine staatlichen Pendants.
Es ist gerade nicht die Routine, sondern es braucht Entdeckergeist; es ist keine Expertenkommission, sondern es sind Erfinder und Unternehmer, die auf eigenes Risiko handeln, die den Fortschritt prägen. Innovation gelinge nur von unten, mit dem Wissen, das unter Millionen Menschen dezentral vorhanden sei, schreiben die Ökonomen Deirdre McCloskey und Alberto Mingardi in „The Myth of the Entrepreneurial State“. Diese Vielfalt äußert sich etwa darin, dass bereits 57 Impfungen gegen Covid-19 in der klinischen und weitere 87 in der präklinischen Phase stehen.
Statt einem innovativen Staat das Wort zu reden, wäre viel gewonnen, wenn sich die Politik der weitverbreiteten Fortschrittsfeindlichkeit entgegenstellte. Die EU und in deren Schlepptau die Schweiz haben sich vor zwanzig Jahren wider besseres Wissen von der grünen Gentechnik verabschiedet.
In der Schweiz dürfte „das Moratorium“ beim Anbau gentechnisch modifizierter Pflanzen deshalb bald bis 2025 verlängert werden. Und die vielversprechende „Genschere“ soll streng reguliert werden, obwohl der Bundesrat anfänglich eine Erleichterung ins Auge gefasst hatte. Ins gleiche Kapitel passt, dass man die Kernenergie und deren Erforschung per se ablehnt, obwohl immer deutlicher wird, dass die Versorgungssicherheit mit Sonne und Wind allein nicht gegeben ist.
Wer vor allem auf gute Rahmenbedingungen pocht, gilt heute als altmodisch. Dabei kommt man damit schon sehr weit: Ein Preis für CO2 würde Investitionen in klimafreundliche Projekte auslösen – ganz ohne Wälzer, der die Wirtschaft in „gut“ und „schlecht“ aufteilt. Es reicht, wenn der Staat die Spielregeln aufstellt; er muss nicht auch noch Schiedsrichter und Spieler sein. Eine umfassend verstandene Zuständigkeit des „innovativen Staates“ schafft kein Klima, in dem Menschen sich entfalten können. Vielmehr stehen sich staatliche Lenkung und Kreativität entgegen.
Hier kann dieser Artikel auch als PDF in der Originalfassung heruntergeladen werden.
Teilen auf