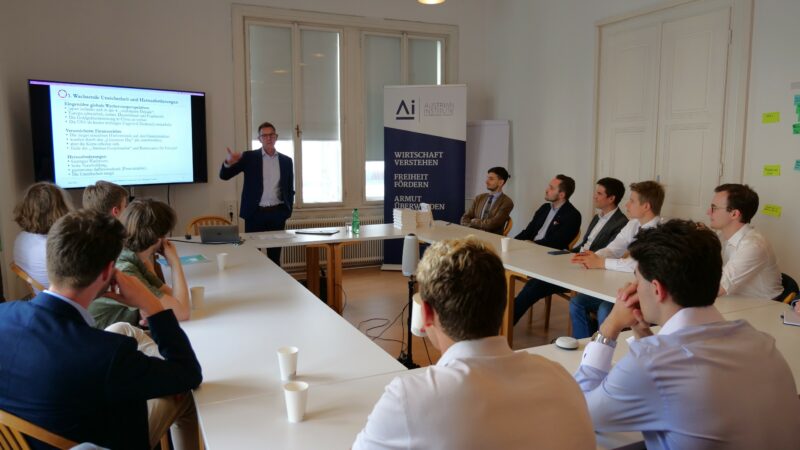Berlin am 4.November 1989: Hunderttausende demonstrieren im untergehenden sozialistischen Paradies der DDR für die Freiheit. Der Sozialismus existiert nur in den Köpfen von Intellektuellen als die bessere Welt. Wird er verwirklicht, zeigt er immer und überall sein hässliches Gesicht. Doch wird das immer wieder vergessen. (Bild: Bundesarchiv/Wikimedia Commons)
Berlin am 4.November 1989: Hunderttausende demonstrieren im untergehenden sozialistischen Paradies der DDR für die Freiheit. Der Sozialismus existiert nur in den Köpfen von Intellektuellen als die bessere Welt. Wird er verwirklicht, zeigt er immer und überall sein hässliches Gesicht. Doch wird das immer wieder vergessen. (Bild: Bundesarchiv/Wikimedia Commons) Die Deutschen müssten immun sein gegen sozialistische Planspiele. Ein Fünftel der Bevölkerung hat den real existierenden Sozialismus bis 1990 am eigenen Leib erlitten, der Rest im Westen muss seit 35 Jahren mit rund vier Prozent der Wirtschaftsleistung für die Schäden der implodierten Planwirtschaft bezahlen. Doch anderes als in den Staaten der ehemaligen Sowjetunion, wo die Menschen den Niedergang aus eigener Kraft reparieren mussten, wurde die gesamtdeutsche Bevölkerung von dieser Kraftanstrengung verschont. Die „blühenden Landschaften“, die Helmut Kohl damals als „Kanzler der Einheit“ leichtfertig versprochen hatte, wurden über eine kaum merkliche Umverteilung aus Steuer- und Sozialkassen sowie Schulden finanziert.
Trotz kommunistischer Verheerungen: andauernde linke Schlachtrufe gegen den Kapitalismus
Die wenigsten Westdeutschen haben den Mut aufgebracht, die kommunistischem Verheerungen vor Ort zu besichtigen. Lieber reiste man in den Süden oder die weite Welt. In Berlin gibt es kaum einen Platz, an dem kein Mahnmal an die Schandtaten des Nationalsozialismus erinnert. Nach Gedenkstätten, die an die von der SED-Diktatur angerichteten Schäden erinnern, muss man hingegen suchen. Die Folgen von diktatorischer Plan- und Zwangswirtschaft wurden allenfalls in den ersten Jahren nach der Wiedervereinigung thematisiert. Und nach und nach der „sozial kalten Marktwirtschaft“ und dem Kapitalismus angelastet.
Wie einst in der DDR rücken Umverteilung und Enteignung in den Vordergrund, der Schutz des persönlichen Eigentums und der (Meinungs-)Freiheit werden hingegen marginalisiert. Für die politische Linke ist der wirtschaftliche Niedergang nur dann ein Thema, wenn sich daraus neue Steuern und Schritte gegen „die Reichen“ ableiten lassen.
So kommt es, dass die Linkspartei als Nachfolgerin der SED mit Schlachtrufen gegen den Kapitalismus und für Enteignung wachsenden Zuspruch findet. In Berlin versucht nun die SPD sogar, mit einem Vergesellschaftungsgesetz die Parolen der Post-Kommunisten links zu überholen. Auf 27 Seiten listen die örtlichen Sozialdemokraten in ihrem „VergRG“ auf, wie sie nicht nur Wohnkonzerne, sondern auch „Energie, Entsorgung und Verkehr“ in Gemeinschaftseigentum überführen will. Am besten mit Entschädigungen unter dem Verkehrswert. Grundlage ist der Volksentscheid von 2021. Damals hatten sich mehr als 56 Prozent der 1,8 Millionen teilnehmenden Berliner dafür ausgesprochen, große Wohnkonzerne wie Deutsche Wohnen und Venovia zu enteignen. Daraus folgt nun ein Vergesellschaftungsrahmengesetz, auf das sich 2023 selbst die CDU eingelassen hat, um mit der SPD eine Landesregierung bilden zu können.
Planwirtschaft und Hedonismus: Subventionierter Wohlfühl-Sozialismus
Man könnte dies als Berliner Posse abtun, wo seit jeher ein „Wohlfühl-Sozialismus“ ersehnt wird, wie es der liberale Grüne Ralf Fücks ausdrückt. Eine Mischung aus Planwirtschaft und Hedonismus, den man sich über Bundeszuschüsse und den Länderfinanzausgleich (seit 2025 wurden allen dafür über 39 Milliarden Euro umverteilt) bezahlen lässt. In der der deutschen Metropole leben nicht nur überdurchschnittlich viele Sozialhilfe-Empfänger, die man großzügig aufnimmt und notfalls rasch mit einem deutschen Pass (und damit Wahlrecht) versorgt. Sie ist eben auch selbst Transferempfänger. Zur Not wird der Schuldenberg von über 67 Milliarden Euro weiter aufgetürmt.
Doch mittlerweile macht die Bundeshauptstadt ihrem Titel alle Ehre: Die Berliner Mentalität, sich den Grundsätzen des soliden Regierens zu entziehen, breitet sich über das ganze Land aus. Alle Ermahnungen – ob von der OECD, der Bundesbank, den Rechnungshöfen oder liberal denkenden Ökonomen – , endlich grundlegende Reformen in Angriff zu nehmen, werden in den Wind geschlagen. Obwohl das deutsche Rentensystem vor dem Kollaps steht, setzt vor allem die mitregierende SPD teure Wahlversprechen durch.
Die Partei, die keine Gelegenheit auslässt, CDU und CSU etwa in der Migrationsfrage vor „rechten Narrative“ zu warnen, übernimmt in der Verteilungsfrage nur zu gerne linke Narrative. Sie ebnet damit der kalten Enteignung den Weg. Obwohl das obere Einkommenszehntel bereits heute mehr als die Hälfte dieses Steueraufkommens trägt, sieht die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Wiebke Esdar „im internationalen Vergleich enorm große Vermögensungleichheit im Land“, weshalb die Reichen „selbstverständlich einen stärkeren Beitrag zum Gemeinwohl leisten müssen“. Sie spricht nicht nur ihrer Partei, sondern der politischen Linken insgesamt aus dem Herzen. Beifall kommt von einem breiten Bündnis aus Gewerkschaften, Kultur, Kirchen, Hochschulen und natürlich allerhand NGOs, die in Deutschland reichlich gemästet werden.
Hinzu kommen die drastisch steigenden Sozialabgaben, die mit heute 42 Prozent bereits den Kipppunkt überschritten haben, an dem das soziale Umlagesystem instabil wird, wie der Wirtschafts-Weise Martin Werding vorrechnet. Und dass Deutschland mit einer Staatsquote von mittlerweile bald 50 Prozent dem Sozialismus näher ist als der Marktwirtschaft, wusste schon CDU-Kanzler Helmut Kohl (ohne darauf allerdings Konsequenzen zu ziehen). Nicht neu sind auch die Warnungen, dass bei einer Abgabenquote von über 50 Prozent das Vertrauen in die Generationengerechtigkeit untergraben wird, worauf nicht nur der Freiburger Finanzwissenschaftler Bernd Raffelhüschen beständig hinweist. Hier droht also tatsächlich Gefahr für die Demokratie.
Schlafende junge Generation
Gerade der drohende weitere Anstieg der Abgabenlast müsste die junge Generation wachrütteln. Doch weit gefehlt. Die Nachwuchsorganisationen von SPD, Grünen und Linke fordern nicht Reformen, sondern noch mehr Umverteilung. Anstatt die Arbeitszeit der wachsenden Lebenserwartung anzupassen, soll vor allem mehr Geld ins marode Sozialsystem gepumpt werden. Dabei haben Jusos und Grüne Jugend vor allem „hohe Kapitalerträge“ im Blick, die „endlich einen Beitrag zur Sicherung der Altersvorsorge leisten müssen“. So fordert es Philipp Türmer, der Vorsitzend der einflussreichen SPD-Jugendorganisation, fast wortgleich mit Jette Nietzard, der scheidenden Sprecherin der Grünen. Tenor: Geld ist genug vorhanden, man muss es nur bei den Reichen holen.
Zu den „Reichen“ gehören allerdings bereits deren Eltern, die millionenfach als Boomer-Generation nun in den Rentenstand wechselt. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) hat deshalb einen „Boomer-Soli“ vorgeschlagen. Danach sollen die geburtenstarken Jahrgänge mit zehn Prozent auf alle Einkünfte zusätzlich besteuert werden, um Rentnern in Altersarmut zu helfen. Anstatt also die teure Rente mit 63 in Frage zu stellen, wird so von einem namhaften Wirtschaftsinstitut eine Vermögensabgabe ins Spiel gebracht. Erstmals werden „Schuldige“ jenseits der üblichen „Milliardäre“ klar benannt und Wege zum Abkassieren vorgezeichnet. Denn: Nur Masse macht Kasse.
Nicht der Verfassungsartikel 14, der das Recht auf Eigentum sowie den Schutz von Erbschaften garantiert und damit den freien Bürger erst möglich macht, steht im Zentrum der Debatte, sondern der folgende Artikel 15, der Enteignungen notfalls erlaubt und aus der Ruinenzeit nach dem Zweiten Weltkrieg stammt. Wie einst in der DDR rücken Umverteilung und Enteignung in den Vordergrund, der Schutz des persönlichen Eigentums und der (Meinungs-)Freiheit werden hingegen marginalisiert. Für die politische Linke ist der wirtschaftliche Niedergang nur dann ein Thema, wenn sich daraus neue Steuern und Schritte gegen „die Reichen“ ableiten lassen.
Dies wiederum erklärt, warum SPD, Grüne und Linkspartei so erbittert darum kämpfen, „ihre“ Staatsrechtlerinnen im Bundesverfassungsgericht zu implementieren: Wenn es schon bei Wahlen nicht zu Mehrheiten reicht, dann wenigstens im obersten Gericht, das über den Regierungen steht. In Karlsruhe werden die Weichen für oder gegen die freie Marktwirtschaft gestellt. Kombiniert durch eine EU-Bürokratie, die das Gemeinwesen zunehmend planwirtschaftlich steuern will.
Alle gegen „Rechts“: Reformunwille der rot-grün-schwarzen Abwehrfront
Der Reformunwille der SPD ist selbst für „Spiegel“ und „Zeit“, beileibe keine neoliberalen Medien, Realitäts- und Arbeitsverweigerung. Die „WirtschaftsWoche“ beschreibt „das Schaudern der Ökonomen“. So wird der Staat, der in seiner (sozialen) Schutzfunktion versagt, delegitimiert – und nicht, wenn Politiker von rechts kritisiert werden, wie etwa die ehemalige Nancy Faeser als ehemalige SPD-Innenministerin behauptete. Aber auch hier ist die politische Linke ganz in der Tradition der DDR: der Kampf gegen die AfD ist für sie ein Kampf gegen den angeblich drohenden Neo-Faschismus.
Dafür wird auch gerne der Verfassungsschutz instrumentalisiert, der die AfD als „gesichert rechtsextrem“ einstuft oder wie jetzt in Ludwigshafen mit fragwürdigen „Beweisen“ hilft, einen AfD-Kandidaten von der Oberbürgermeister-Wahl auszuschließen. Um die stärkste Oppositionspartei von jeder Form der Machtteilhabe fernzuhalten, schließen sich Sozialdemokraten, Christdemokraten, Grüne und Linke jeweils umgehend zu einer sozial-christlich-ökologischen Abwehrfront zusammen, die sie dann „demokratische Mitte“ nennen. Wobei die CDU als bürgerliches Stützrad fungieren darf und notgedrungen sogar mit den Post-Kommunisten paktiert. Etwa um die marktwirtschaftlichen Schuldengrenzen dauerhaft einzureißen.
In der DDR hieß dieses Bündnis SED: Sozialistische Einheitspartei. Das Ergebnis ist bekannt – aber offenbar vergessen. In diese Richtung hört man in Deutschland kein „Nie wieder ist jetzt!“.