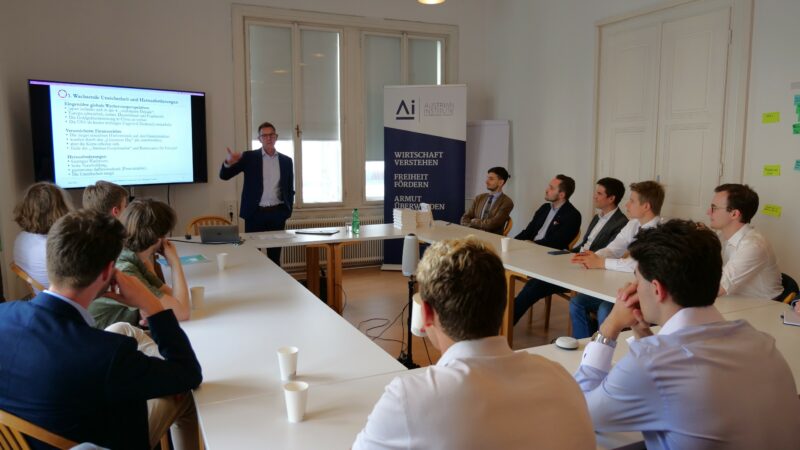Nicht das Verteilen des halben Mantels, sondern die Schaffung von Mantelfabriken schafft Wohlstand. Eine Replik auf Peter Schallenberg (erschienen in DT vom 25.2.2017, S. 14)
In seiner Antwort „Barmherzigkeit schafft Wohlstand“ (DT 18.2.) auf mein Interview mit der FAS („Barmherzigkeit schafft keinen Wohlstand“, 12.2.2017) gibt mein Kollege Peter Schallenberg mir insofern Recht, als auch er die Äußerungen von Papst Franziskus über eine „Wirtschaft, die tötet“ auf dem Hintergrund der Erfahrungen „unerträglicher sozialer Unterschiede und Zerklüftungen“ und „schreiender Armut“ in Lateinamerika versteht. Schallenberg rechtfertigt dann aber die generelle Kritik des Papstes an der freien Marktwirtschaft, indem er jene traurige Wirklichkeit in einen Topf wirft mit einem angeblich in der entwickelten Welt existierenden „‘Casino-Kapitalismus‘ ohne Regeln und Gesetze und Anstrengung zur Umverteilung und zur gerechten Besteuerung“, der, so Schallenberg, zur Finanzkrise von 2007 und zur nachfolgenden Wirtschaftskrise geführt habe.
Interventionismus, nicht Kapitalismus schafft Krisen
Dem ist entschieden zu widersprechen. Ursache der Finanzkrise von 2007 waren keineswegs nichtregulierte Märkte, sondern eine Politik, die Banken gesetzlich verpflichtete, jedem Amerikaner den Erwerb eines Eigenheims zu ermöglichen sowie entsprechende Staatsgarantien für Kreditausfälle und eine Politik des billigen Geldes, die den so verursachten Immobilienboom anheizte. Unverantwortliche Praktiken von Finanzinstituten mit verbrieften Subprimekrediten und „Casino-Kapitalismus“ waren die Folge dieser Abschiebung des Risikos auf den Steuerzahler. Gewinnorientiertes unternehmerisches Handeln in einem freien Markt ohne Einmischung von Staat und Politik hätte weder ein solches Verhalten noch das nachfolgende Desaster jemals hervorgebracht. Ähnliches gilt für die 1929 beginnende Weltwirtschaftskrise – auch hier war eine Politik des billigen Geldes Ursache des Übels –, wie auch für die großen Krisen des 19. Jahrhunderts, etwa die Weltwirtschaftskrise von 1873: Das in den USA durch die politische Förderung und staatliche Subventionierung des Eisenbahnbaus entstandene Spekulationsfieber riss die gesamte Weltwirtschaft mit sich. Enormes soziales Elend war die Folge.
Verursacher der großen Wirtschaftskrisen, wie auch der Bildung von schädlichen Monopolen und Kartellen, waren nicht Kapitalismus und freie Marktwirtschaft, sondern Staatsinterventionismus. So im 19. Jahrhundert zum Beispiel die deutsche Schutzzollpolitik. Bismarck wie auch Vertreter der Historischen Schule der Nationalökonomie – die „Kathedersozialisten“ – verunglimpften die Idee des Freihandels als „Manchestertum“, eine Diffamierung, die bis heute anhält. Gerade in Deutschland förderten sie die Vorstellung, „Marktwirtschaft“ sei als solche nicht sozial, erst durch staatliche Lenkung werde sie in den Dienst des Gemeinwohls gestellt. Ausgerechnet Alfred Müller-Armack, einer der Gründerväter einer so verstandenen Sozialen Marktwirtschaft, schrieb jedoch 1947, „dass die Hauptursachen für das Versagen der liberalen Marktwirtschaft gar nicht so sehr in ihr selbst liegen, als in einer Verzerrung, der sie durch den von außen kommenden Interventionismus seit dem Ende des vergangenen Jahrhunderts zunehmend unterlag“. Und Alexander Rüstow meinte 1945, die „Entartung der Marktwirtschaft“ sei „direkt und indirekt durch gehäufte subventionistische, protektionistische und monopolfördernde Maßnahmen des Staates herbeigeführt worden, (…) d.h. aber durch einen flagranten Verstoß gegen die Grundmaxime des Liberalismus: Laisser-Faire, Laissez Passer.“ Sehr richtig: Schädliche Monopole sind jene, die der Staat schafft oder schützt.
Aus der Legende, Schuld an den Krisen der Vergangenheit sei der „ungezügelte Kapitalismus“ gewesen, nährt sich der – sehr deutsche – Mythos von der absoluten Überlegenheit der Sozialen Marktwirtschaft und der katholischen Soziallehre als deren authentischen Interpretation. Als Kontrastfolie dient Schallenberg die USA und ihr angeblich unsozialer Kapitalismus. Er unterschlägt, dass es gerade die groß angelegten Sozialhilfeprogramme seit Präsident Johnson waren, die in den USA die Konservierung bestehender und die Entstehung neuer Armut bewirkten. Das System wurde von Präsident Clinton reformiert – allerdings zu spät, um das Verharren weiter Bevölkerungsschichten in der Armutsfalle rückgängig machen zu können. Indes wurden in den letzten Jahren durch Regulierungen und hohe Körperschaftssteuern in den USA unternehmerische Initiative und damit die Schaffung von Arbeitsplätzen behindert – in Zeiten der Globalisierung und des rasanten technologischen Wandels eine wirtschaftspolitische Todsünde.
Für Ludwig Erhard war der Wettbewerb sozial
Was überhaupt war ursprünglich mit „Sozialer Marktwirtschaft“ gemeint? Ludwig Erhard, ihr überaus erfolgreicher Schöpfer, war ein dezidierter Gegner einer Politik des „sozialen Ausgleichs“ und von Umverteilung – nachzulesen in seinem Buch „Wohlstand für alle“ aus dem Jahre 1957. Zudem vertrat er die Ansicht, die „Entwicklung zum Versorgungsstaat“ sei „schon dann eingeleitet, wenn der staatliche Zwang über den Kreis der Schutzbedürftigen hinausgreift“. Jede Form der steuerfinanzierten Umverteilung sei „Flucht vor der Eigenverantwortung“. Sie führe zu einer gesellschaftlichen Ordnung, „in der jeder die Hand in der Tasche des anderen hat“, zur „Aufblähung der öffentlichen Haushalte“ und zunehmenden Abhängigkeit des Bürgers vom Staat. Eine präzise Beschreibung dessen, was Schallenberg als „systemisch organisierte Nächstenliebe“ anpreist.
Das Soziale an der Sozialen Marktwirtschaft war für Erhard der marktwirtschaftliche Wettbewerb. In einer wettbewerblichen Marktwirtschaft, eingebunden in eine Rechtsordnung mit klaren Regeln, kann jeder Bürger zu leistungsgemäßem Wohlstand gelangen. Arbeitsunfähigen hilft die Gemeinschaft. Mit seinem Lehrer Franz Oppenheimer war Erhard der Meinung, Monopole und Kartelle würden die Kaufkraft des Konsumenten verringern und seien deshalb unsozial. Doch war Erhard hier weniger radikal als die Ordoliberalen, die sämtliche Konzerne beseitigen wollten und Ansichten vertraten, auf die sich heute Sahra Wagenknecht berufen kann.
Müller-Armack vertrat eine eher staatsorientierte Konzeption der Sozialen Marktwirtschaft. Sie begann sich nach Erhards Abgang aus der Politik, vor allem aber mit der sozialliberalen Koalition ab 1969 durchzusetzen. Von da an ging die Entwicklung genau in die Richtung, vor der Erhard gewarnt hatte. Mit dem anfänglichen Konzept – auch demjenigen der Freiburger Ordoliberalen – hat die heutige, zu einer gigantischen Umverteilungsmaschinerie mutierte Soziale Marktwirtschaft wenig zu tun. Sie konnte nur dank der Arbeitsmarktreformen von Schröders Agenda 2010 vor dem Kollaps gerettet werden – eine Reform, die allerdings genau aufgrund der von Schallenberg befürworteten Logik „systemisch organisierter Nächstenliebe“ nun Schritt für Schritt rückgängig gemacht wird. Das zunehmend schuldenfinanzierte Erfolgsmodell könnte sehr bald zum kollektiven Albtraum werden.
Dieses System ist nicht nur deshalb problematisch, weil es die individuelle Freiheit und Selbstverantwortung aushöhlt und weitgehend die Familie funktionslos macht, bzw. als Vorsorge- und Solidargemeinschaft zerstört, sondern auch, weil es alle – vor allem aber den Mittelstand und die untersten Schichten – ärmer macht, indem es die Vermehrung von Wohlstand behindert, gerade auch für die kommenden Generationen. Das gilt auch für flächendeckende Mindestlöhne, die Schallenberg befürwortet: Damit werden die Geringstqualifizierten ausgegrenzt und in die Sozialhilfe geschoben. Der gegenwärtige Sozialstaat ist ein System, das nicht mehr Wohlstand schafft, sondern durch falsche Anreize und hohe Steuerlast Ressourcen, die produktiv verwendet werden könnten, in den Konsum umlenkt, was nichts anderes bedeutet als der Schaffung von mehr „Wohlstand für alle“ entgegenzuwirken.
Schallenberg anerkennt zwar die Bedeutung des Unternehmertums, verkennt aber dessen entscheidende Leistung für das Gemeinwohl. Nicht das Verteilen des halben Mantels, sondern die Schaffung von Mantelfabriken schafft Wohlstand! Die „systemisch organisierte Nächstenliebe“ des steuerfinanzierten Sozialstaates wird von Schallenberg mit dem Klischee begründet, die „Starken und die Reichen“ hätten „solidarisch zu sein mit den Schwächeren und Ärmeren“. Das müssen sie natürlich, und nicht nur aus Barmherzigkeit – jedoch nicht aufgrund staatlichen Zwangs. Die Argumentation lässt unberücksichtigt, dass Unternehmer – das „Kapital“ – die Menschen in Lohn und Brot bringen und so auch den größten Teil des Steuersubstrats generieren. Schallenberg hingegen spricht von „der sanften Gewalt der Besteuerung“, mittels derer der Sozialstaat die Reicheren „zu effektiver Barmherzigkeit, die sich Solidarität nennt“ führe. Das, wie auch seine Ansicht, Barmherzigkeit müsse verordnet, mit Zwang durchgesetzt werden, ja, der Staat habe die erzieherische Funktion, aus erbsündigen Egoisten tugendhafte Menschen zu machen, widerspricht nicht nur allen gesunden moralischen Prinzipien, sondern wirkt geradezu zynisch: Die „sanfte Gewalt der Besteuerung“, die Bürgern bis zur Hälfte ihres hart erarbeiteten Einkommens wegnimmt und sie damit moralisch bessern soll, ist diejenige des staatlichen, polizeibewehrten Gewaltmonopols sowie – will man im Falle der Kirchensteuern diesem ausweichen – in Deutschland zusätzlich die kirchliche Drohung mit der Exkommunikation!
Besinnung auf staatskritische Traditionen der Soziallehre
Nicht Besteuerung generell, aber staatlich erzwungene Nächstenliebe ist eine grobe Missachtung des Rechts auf Privateigentum und des Subsidiaritätsprinzips. Gewiss: Eigentum verpflichtet. Das verleiht aber nicht dem Staat das Recht, dieser moralischen Verpflichtung mit Zwang nachzuhelfen. Dem steht die Mahnung des katholischen Sozialpolitikers Georg von Hertling aus dem Jahre 1893 entgegen: „Die Bruderliebe zur Grundlage staatlicher Maßnahmen machen, heißt, die Competenz der Staatsgewalt überschreiten und zugleich die Bruderliebe in ihrem Lebensnerv angreifen.“ Bischof von Ketteler hatte schon Jahre zuvor „das Project der durch Majoritäten decretierten Staatshilfe“ als Verirrung gegeißelt. Deren Ergebnis sei „ein immer weiter ausgebildetes Steuer- und Zwangssystem, an dem sämtliche Staaten fast zu Grunde gehen und bei denen freie Selbstbestimmung und Gesinnung gänzlich in den Hintergrund treten“. Erst mit Heinrich Peschs Solidarismus, der soziale Gerechtigkeit „zum Wohle des Volksganzen“ als staatliche Veranstaltung verstand und sich an der Lehre der bereits erwähnten Kathedersozialisten orientierte, insbesondere derjenigen Adolph Wagners, wurde diese klassische Tradition der katholischen Sozialethik aufgegeben.
Wir täten gut daran, uns auf die ältere, staatskritische und freiheitsorientierte Tradition der katholischen Sozialethik zu besinnen. Als „pure Polemik“ bezeichnet Schallenberg meine Meinung, für eine spezifisch kirchliche Soziallehre gebe es keine theologischen Vorgaben in der Offenbarung und deshalb sei sie dem Zeitgeist ausgeliefert. Als Gegenargument beruft er sich auf die biblische und christliche Tradition, die eine Fülle von „Vorgaben für das soziale Leben in Nächstenliebe und Solidarität“ enthalte. Offenbar hat er nicht richtig gelesen: Nicht von sozialethischen Vorgaben für das individuelle Handeln war in dem Interview die Rede, sondern von einer kirchenamtlichen Lehre über die Ordnung von Staat und Wirtschaft. Eine solche findet sich weder in der Heiligen Schrift noch in der Tradition. Doch fügte ich hinzu: „Jeder einzelne Christ hat natürlich eine soziale Verantwortung, und dazu sollen Papst und Bischöfe die Gläubigen immer wieder aufrufen.“
Was wir nicht brauchen, so meine Meinung, sind Bischöfe und Theologieprofessoren, die den Gläubigen Vorgaben machen, wie sie als Christen über Fragen der Wirtschaftsordnung und der Sozialpolitik denken und entsprechend handeln sollten. Das halte ich für eine Missachtung der legitimen Freiheit der Gläubigen, insbesondere der Laien. Es spaltet die Gläubigen und schafft Polarisierungen, die nicht sein müssen, weil sie mit der eigentlichen Aufgabe des kirchlichen Lehramtes nichts zu tun haben und wir uns als Christen nicht auf das Evangelium berufen sollten, um unsere politischen Präferenzen zu begründen.