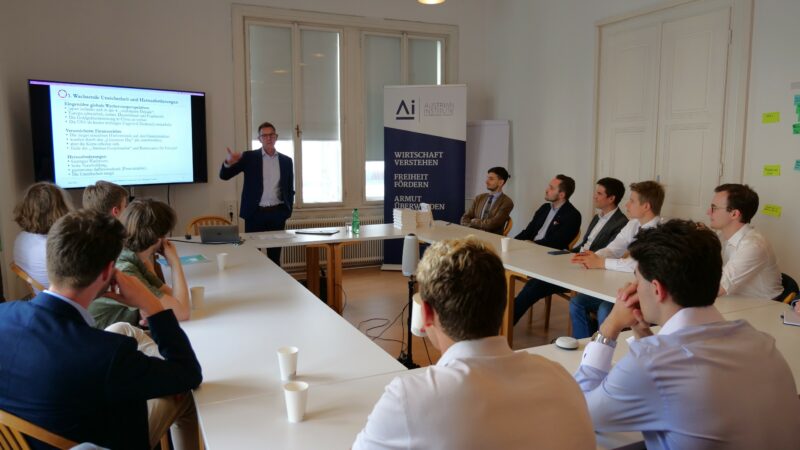Am 5. Juni stimmt die Schweiz über die Volksinitiative «Für ein bedingungsloses Grundeinkommen» ab. Der Staat soll bei Annahme der Initiative für ein bedingungsloses Grundeinkommen sorgen. Wie hoch dieses sein soll wird nicht explizit festgelegt, doch es soll der ganzen Bevölkerung ein menschenwürdiges Dasein und die Teilnahme am öffentlichen Leben ermöglichen. Ein monatlicher Beitrag von 2500 Franken pro Kopf (625 Franken für unter 18-Jährige) wurde als Minimum erachtet um ein solches Dasein zu ermöglichen. Basierend auf den Berechnungen für das Jahr 2012 würde dies den Staatshaushalt um zusätzliche 208 Milliarden Franken belasten. Einig sind sich die Regierung und ein Teil der Initianten darin, dass der grösste Teil des Grundeinkommens über die bestehenden Löhne finanziert werden müsste. Hinzu käme ein Transfer aus den Sozialleistungen, die durch die Initiative angeblich obsolet würden. Über die genauen Beträge und in welcher Form der Besteuerung sie erhoben werden sollen, ist man sich jedoch nicht einig.
Ausser den Grünen haben sich alle Parteien und Organisationen gegen ein solches Einkommen ausgesprochen. Dennoch hat sich in der Schweiz eine rege öffentliche Debatte um die Frage entwickelt, ob eine solch utopisch anmutende Initiative nicht doch eine passende Antwort auf die gefühlten wachsenden sozialen Kosten der Globalisierung sein könnte.
Angst vor Globalisierung und Wettbewerb
Es ist tatsächlich so wie es Josef Schumpeter in seinem Buch ‚Capitalism, Socialism and Democracy‘ (1942) vorausgesehen hat: der Kapitalismus läuft Gefahr an seinem eigenen Erfolg zu scheitern, denn all seine Errungenschaften werden in Wohlstandsgesellschaften für garantiert angenommen, während die Risiken des wirtschaftlichen und technologischen Wandels auf immer weniger Akzeptanz stossen. Sie erzeugen Angst und Unsicherheit und den Wunsch nach neuen Gewissheiten, die einfache Erklärungen für komplexe globale Ereignisse bereithalten.
Offene Märkte erzeugen eine heterogene und komplexe Gesellschaft, die viele materielle Bedürfnisse besser befriedigt, als ein durch Abschottung geprägtes Wirtschaftssystem. Und dennoch sehnen sich viele nach einer sinn- und identitätsstiftenden Gemeinschaft, die sich zurückzieht, um sich auf gemeinsame ursprüngliche Werte zu besinnen. Nur in einer solchen Gemeinschaft kann man auf Würde, Solidarität, Respekt und Anerkennung hoffen, während sich ja sonst kaum jemand um einen kümmert, wenn nicht etwas dabei ‚rausschaut‘. Dieses Gefühl der mangelnden Anerkennung der Gesellschaft, zeigt sich insbesondere darin, dass man ständig mit anderen im Wettbewerb steht, und dass Tugenden wie Bescheidenheit und Ehrlichkeit keine Selektionskriterien sind. Schlussendlich muss der Lebensunterhalt mit einer Beschäftigung verdient werden, die kaum den eigenen Vorstellungen entspricht. Man fühlt sich entfremdet und fremdbestimmt.
Das ‘Bedingungslose Grundeinkommen‘ (BGE) soll nun die Autonomie des Einzelnen stärken. Es entlastet vom Zwang sich um den erstbesten Job zu bewerben und eröffnet neue Möglichkeiten, den eigenen Interessen nachzugehen und selbst gestalterisch tätig zu werden. Ausserdem hat man wieder mehr Zeit für soziales Engagement innerhalb und ausserhalb der Familie. Kurzum, das BGE kann zu einem erfüllten Leben beitragen.
Ein grundlegender Denkfehler: Die Verwechslung der gemeinschaftlichen Kleingruppe mit der Grossgesellschaft
Was könnte an dieser Überlegung falsch sein? Rein intuitiv verleitet uns der Gedanke eines BGE zum Glauben an ein von den gesellschaftlichen Zwängen befreites Individuum, was schlussendlich auch zu einer besseren und gerechteren Gesellschaft führen sollte.
Der grundlegende Denkfehler hat Friedrich August von Hayek 1944 in seinem Buch ‚The Road to Serfdom‘ (‚Der Weg zur Knechtschaft‘) dargelegt: Er argumentiert darin, dass totalitäre Systeme auf der Annahme basieren, dass die Regeln der Gemeinschaft, die auf Solidarität, Fürsorge und Unentgeltlichkeit beruhen, auf die Gesellschaft als Ganzes (die ‚Great Society‘ oder ‚Grossgesellschaft‘) übertragen werden können. Doch sei das nicht möglich, denn im Gegensatz zu den kleinen Gemeinschaften funktioniert die anonyme Grossgesellschaft nach den Regeln der politischen Ökonomie, d.h. den Regeln des gegenseitig vorteilhaften Tausches (‚Katallaxie‘) die sowohl die Marktwirtschaft wie auch die Demokratie bestimmen. Sie basieren auf der Annahme, dass jeder primär seine Eigeninteressen im Wettbewerb mit anderen verfolgt. Die Kunst einer guten Marktregelung oder einer guten Verfassung besteht darin, die Regeln so auszugestalten, dass sich die Verfolgung des Eigeninteresses nicht destruktiv, sondern konstruktiv auf die Gesellschaft als Ganzes auswirkt. Vielen klingt das jedoch zu pragmatisch und zu wenig ethisch. Der Mensch tendiert nämlich dazu, alle Strukturen, die er in einer Gesellschaft vorfindet nicht irgendwelchen Institutionen, sondern einer Macht zuzuschreiben, welche diese Strukturen schafft und kontrolliert. Und weil man diese Macht nicht klar identifizieren kann, fühlt man sich machtlos und verachtet die anonyme Gesellschaft als eine fremdbestimmte Masse, die nicht auf gemeinsames Handeln und konstruktive Zusammenarbeit setzt, sondern sich im Wettbewerb um knappe Güter ereifert und dabei das Allgemeinwohl ignoriert.
Das BGE verspricht den Abschied von diesem egoistischen Wettbewerbsdenken und die Möglichkeit einer Arbeit in der Gemeinschaft nachgehen können, die uns als sinnvoll erscheint und von der wir glauben, dass sie unseren Fähigkeiten und Interessen am besten entspricht. Diese vom BGE subventionierte Arbeit befreit uns vom Wettbewerbsdenken und schafft Wert, indem sie sich am Gedanken der Solidarität und der gegenseitigen Wertschätzung orientiert.
Doch kann das funktionieren? Ist nicht der durch Innovation und Unternehmertum geschaffene Wohlstand der Gesellschaft letztendlich ein Resultat des Wettbewerbsdrucks? Ausserdem basiert die effektive Solidarität in der Gemeinschaft nicht auf Altruismus, sondern dem Eigeninteresse ihrer Mitglieder. Als ich meine Diplomarbeit in einem Bergdorf in Guatemala zum Verschuldungsproblem von Kleinbauern schrieb, war ich zutiefst beeindruckt von der starken Solidarität, die im Dorf praktiziert wurde. Jeder musste mindestens ein Jahr Freiwilligendienst im Dorf leisten. Das heisst Strassen ausbessern, Abfall entsorgen, öffentliche Gebäude sanieren, Gemeindeversammlungen organisieren, usw. Das wären eigentlich Aufgaben, die vom öffentlichen Sektor übernommen werden müssten. Da dieser jedoch oft korrupt ist oder schlichtweg keine Mittel hat, müssen sich die Leute selbst organisieren. Sie sind gezwungen, im Eigeninteresse solidarisch zu handeln.
Je mehr Aufgaben jedoch der Staat übernimmt, desto stärker nimmt dieser Zwang zur lokalen Zusammenarbeit ab. Der unmittelbare Nachbar wird zum Fremden, denn es gibt kaum mehr gemeinsame Interessen. Daher das Dilemma: je fürsorglicher der Staat, desto geringer die unmittelbare Solidarität in der lokalen Gemeinschaft – und desto grösser die Klagen über die gesellschaftliche Gleichgültigkeit und Kälte.
Das Problem mit postmateriellen Wertegemeinschaften
Die neuen Gemeinschaften in post-materiellen Gesellschaften sind weniger gebunden an eine generationenübergreifende und standortbedingte Solidarität. Es sind frei gewählte und daher eher homogene Wertegemeinschaften. Man sucht sich Gleichgesinnte aus, welche denselben Lifestyle pflegen oder dieselbe Weltanschauung teilen. Es geht um die Schaffung einer gemeinsamen Identität.
Doch wie fruchtbar sind solche Gemeinschaften für das Wohlergehen der Gesellschaft als Ganzes? Widersprüche und Widerstände muss man in einer identitätsstiftenden Gemeinschaft kaum aushalten, denn man teilt ja dieselben Werte und dieselbe Weltsicht. Zumeist stammen die Mitglieder aus dem gleichen sozialen Milieu und derselben Generation. Dies schafft ein ‚Wir‘-Gefühl, also eine ‚In-Group‘, die sich über die Abgrenzung zur ‚Out-group‘, also ‚den Anderen‘, definiert.
Das BGE wird in solchen post-materiellen Wertegemeinschaften primär als Taschengeld verstanden, mit dem man etwas gemeinsam unternehmen kann. Dabei wird das monatliche Taschengeld, sobald es einmal fliesst, als Grundrecht verstanden. Und wenn diese Vorstellung einmal verankert ist, wird es kaum ein Politiker wagen, den Abbau dieses Grundrechtes in wirtschaftlich schwierigen Zeiten zu fordern. Das sind die Regeln der politischen Ökonomie oder ‚Politics of Entitlement‘, wie sie der Ökonom Paul Romer (1996) nennt. Dabei wird die Solidarität auf Gesellschaftsebene kaum gefördert, denn die Leute werden primär ihre gesellschaftliche Rechte ausschöpfen (sprich sie werden ihr bedingungsloses Grundeinkommen beziehen), doch verpflichtet fühlen sie sich dennoch nur ihrer Wertegemeinschaft.
Hinzu kommt, dass wir bereits in einer Gesellschaft mit hohen Ansprüchen an den Staat leben. Bauern erachten ihre Direktzahlungen als eine Art Menschenrecht und die Nutzniesser von bestehenden Sozialinstitutionen werden kaum kompromissbereit sein, wenn es um das partielle Ersetzen ihrer jetzigen Bezüge durch ein Grundeinkommen geht, denn diese sind oftmals weitaus höher als 2500 Franken pro Monat.
Fördert das bedingungslose Grundeinkommen Unternehmertum?
Die Befürworter betonen, dass ein BGE nicht zu mehr Freizeitvergnügen, sondern im Gegenteil, zu mehr Unternehmertum führen wird, da wir ja alle intrinsisch, also aus innerem Antrieb, und nicht extrinsisch, also wegen des materiellen Lohnes, arbeiten würden.
Verantwortungsvolle und innovative Unternehmer zeichnen sich allerdings gerade dadurch aus, dass sie materiellen Wert schaffen, mit dem sie sowohl zum Gemeinwohl wie auch zur Finanzierung eines Wohlfahrstaates beitragen. Ihr Erfolg in der Wirtschaft besteht darin im globalen Wandel nicht nur ein Risiko, sondern auch eine Chance zu sehen. Im Rahmen der gesellschaftlich festgelegten Regeln verfolgen sie ihre Interessen und schaffen zugleich Wert durch Innovationen, die der Gesellschaft als Ganzes zu Gute kommen.
Das Unternehmertum, das durch ein Grundeinkommen ermöglicht werden soll, hat dagegen mehr mit dem Wunsch nach Selbstverwirklichung zu tun. Jeder will das machen, wozu er glaubt, bestimmt zu sein. Dabei spielt die tatsächliche Nachfrage nach der individuellen Tätigkeit kaum eine Rolle. Man braucht nicht zwingend kundenorientiert zu arbeiten.
Das hohe Selbstwertgefühl der Schweizer lässt es kaum zu, sich mit irgendeinem Job zufrieden zu geben. Insbesondere, wenn dieser ein geringes Ansehen in der Gesellschaft hat und als wenig kreativ gilt. Solche Jobs sind jedoch unabdingbar für das Funktionieren der Gesellschaft und im Speziellen unserer Infrastruktur. Erst der Unterhalt dieser Infrastruktur macht ein erfolgreiches und unabhängiges Unternehmertum überhaupt möglich. Das ist uns heute kaum noch bewusst.
‚Kreative‘ Unternehmer haben kaum Zeit und wohl auch kaum Interesse sich mit Bürokram, Reinigung, Unterhalt und anderen Routinearbeiten zu beschäftigen. Auch das Pflücken von Früchten und Gemüsen im Akkord für unsere Supermärkte oder die Pflege unserer pensionierten Verwandten, überlassen wir gerne Anderen. Doch wer sind diese Anderen genau, wenn doch alle vom bedingungslosen Grundeinkommen profitieren sollen? Es sind die Einwanderer, die keine langfristige Aufenthaltsbewilligung haben. Sie werden in die Lücke springen und die weniger attraktiven Jobs übernehmen. Wahrscheinlich profitieren auch sie indirekt, denn das verknappte Angebot an Arbeitskräften im Niedriglohnbereich wird zu Lohnsteigerungen führen, aber eventuell auch zu einer Verminderung der Qualität der Leistungen (da ja oft ein Lehrabschluss fehlt). Die Schweiz würde daher viel attraktiver für Schwarzarbeit, was nicht nur die Schattenwirtschaft zum Blühen bringen würde, sondern auch unweigerlich zu einer ausgeprägteren Zweiklassengesellschaft führte.
Trotz dieser Kritik kann die Idee eines Grundeinkommens nicht einfach von der Hand gewiesen werden. Kleinere Pilotprojekte (e.g. Mincome in Kanada) konnten aufzeigen, dass ein Grundeinkommen für die Bedürftigen – vorausgesetzt, dass es auf Gemeindeebene umgesetzt und finanziert wird – durchaus positive Resultate zeitigen kann. Es verschafft Leuten in Not den nötigen Freiraum um aus einem unproduktiven Hamsterrad rauszukommen.
Solidargemeinschaften bilden sich auf Gemeindeebene und nicht auf Staatsebene
Das bedingungslose Grundeinkommen als Vehikel für die Realisierung einer uneingeschränkten Solidargemeinschaft auf nationaler Ebene kann jedoch nicht funktionieren, denn, wie Hayek und der spätere Ökonomienobelpreisträger Vernon Smith richtig erkannt haben, zerstört man den Solidaritätsgedanken, wenn man versucht, die Regeln der fürsorgenden Gemeinschaft auf die wettbewerbsorientierte Gesellschaft als Ganzes zu übertragen. Fürsorgliche Solidarität ist nicht einfach gut und Wettbewerb einfach schlecht. Moralisches Versagen tritt nämlich immer dann ein, wenn dort Kooperation herrscht, wo eigentlich Wettbewerb herrschen sollte und umgekehrt.
Ausserdem kann eine Ethik, die auf individueller Ebene plausibel erscheint, auf gesellschaftlicher Ebene kontraproduktiv sein. Mit anderen Worten, ein gutes Leben führen ist nicht dasselbe wie ein Land in Verantwortung zu führen. Diese Einsicht wird im Sammelband von Philipp Aerni, Klaus-Jürgen Grün und Irina Kummert zum Thema ‚Schwierigkeiten mit der Moral‘ eingehend erläutert.
Durch die Missachtung dieser Grundeinsichten, bestünde bei der Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens daher die Gefahr, dass unerwünschte Nebeneffekte erzeugt würden, die das erstrebte Ziel von mehr Fairness und Chancengleichheit in der Gesellschaft nicht fördern, sondern vielmehr untergraben.
Literatur:
Aerni, P., Grün K.-J., Kummert, I. (2015) Schwierigkeiten mit der Moral: Ein Plädoyer für eine neue Wirtschaftsethik. Springer Gabler, Wiesbaden.
Aerni, P. und Grün, K-J. (2011) ‘Moral und Angst’. Vandenhoeck & Ruprecht Verlag, Göttingen.
Hayek, F. A., & Caldwell, B. (2014) The Road to Serfdom: Text and Documents: The definitive edition. Routledge (dt.: Der Weg zur Knechtschaft. Übers. Von Eva Röpke, hg. Von Manfred E. Streit, Friedrich A. von Hayek Gesammelte Schriften in deutscher Sprache, Abteilung B, Bd. 1, Mohr Siebeck, Tübingen 2004).
Romer, Paul M. (1996) ‘Preferences, Promises, and the Politics of Entitlement,’ in: Victor R. Fuchs (ed.), Individual and Social Responsibility: Child Care, Education, Medical Care, and Long-Term Care in America (pp. 195-228). University of Chicago Press, Chicago.
Schumpeter, Joseph A. (2013) Capitalism, Socialism and Democracy. Routledge (dt.: Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie, Einleitung von Edgar Salin, Francke, Bern 1946).
Smith, Vernon (2001) Handeln in zwei Welten. NZZ, 10.08.2001