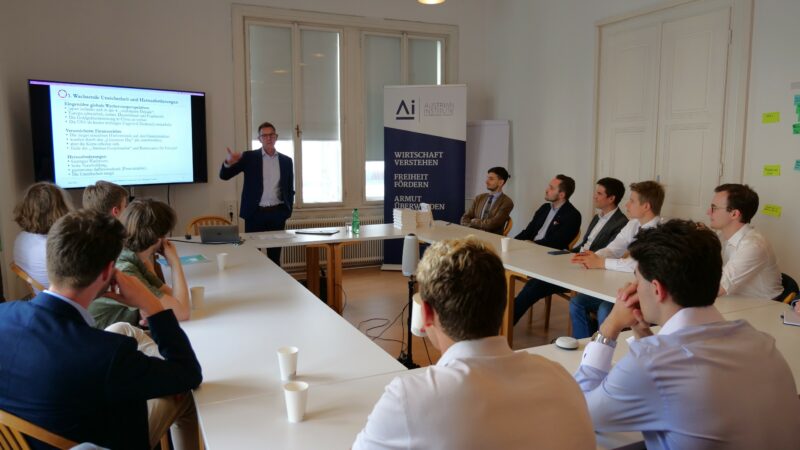Bank sign on glass wall of business center
Bank sign on glass wall of business center Geld ist das wichtigste Element einer Marktwirtschaft. Dennoch wird es nicht vom Markt, sondern vom Staat erzeugt und geregelt: So F. A. Hayek in seinem Spätwerk „Entstaatlichung des Geldes“ (1976). Als Lösung schlägt er einen freien Wettbewerb der Währungen vor, die von privaten Banken herausgegeben werden. Damit sollte die Wirtschaft wesentlich weniger krisenanfällig werden. Es ist ein Gedankenexperiment, das historische Vorbilder hat, die jedoch in der Öffentlichkeit kaum bekannt sind. Auch wenn das Konzept eines entstaatlichten und durch den Markt geregelten Geldsystems noch nicht ausgereift sein mag – sich damit zu beschäftigen erscheint nützlich, um mögliche Alternativen zum heutigen inflationären und von der Politik zum Schaden der Allgemeinheit missbrauchten Staatsgeld zu finden.
Ein staatliches Vollgeldsystem wäre keine Lösung: Die Schweizer werden 2017 oder 2018 über die Eidgenössische Volksinitiative „Für krisensicheres Geld: Geldschöpfung allein durch die Nationalbank!“, die sogenannte Vollgeldinitiative abstimmen. Danach müssten die Banken die Zahlungsverkehrskonten ihrer Kunden außerhalb der Bilanz führen, womit sie nicht mehr zur Konkursmasse gehörten. Die Geldschöpfung durch die Banken wäre dadurch verboten, nur noch der Staat, d.h. die Nationalbank, dürfte Münzen, Banknoten und Buchgeld als gesetzliche Zahlungsmittel schaffen. Der Staat würde also noch mächtiger!
Im Sinne von F. A. Hayek plädiert Peter Keppeler hingegen für eine konsequent marktwirtschaftliche Lösung: staatsloses Geld.
In einem marktwirtschaftlichen Geldsystem gäbe es Banken, die eigenes Geld herausgeben – sogenannte Emissionsbanken – und andere, die Dienstleistungen, wie z.B. Kontoführung und Vermögensverwaltung, erbringen. Schottland kannte von 1716 bis 1845 das sog. „free banking“. Das schottische Parlament gründete zwar 1695 die Bank of Scotland und gewährte ihr ein Monopol für 21 Jahre für das Bankgeschäft und die Ausgabe von Noten. Das Monopol wurde aber 1716 nicht verlängert. Trotz ihres Namens war diese Bank keine staatliche Institution und sie war auch nicht reguliert. Die Proteste der Bank of Scotland bei der britischen Regierung gegen die Bewilligung einer Konkurrentin verhallten ungehört (die schottische Krone wurde schon 1603 mit der englischen vereinigt, und 1707 wurden auch die Parlamente der beiden Länder zusammen gelegt). So wurde dann ebenfalls in Edinburgh 1727 eine weitere Bank gegründet, die Royal Bank of Scotland. Der verbissene Wettbewerb zwischen den beiden Banken erwies sich als innovationsfördernd. So konnten z.B. Kunden in Schottland ab 1731 verzinste Konten eröffnen, lange bevor dies in England möglich war.
Mehr Stabilität ohne Zentralbank
In den folgenden Jahrzehnten entstanden laufend neue Banken, die teilweise auch eigene Banknoten herausgaben. 1769 waren es bereits zweiunddreißig. Bis 1760 waren die Hauptsitze der Banken noch auf Edinburgh und Glasgow konzentriert, breiteten sich dann aber über das ganze Land aus. Da es keine Zentralbank gab, konnten die Banken selbst Noten herausgeben, die sie gegenseitig ohne weiteres zu pari akzeptierten. Sie lauteten jeweils auf das Pfund und waren mit dem Namen der herausgebenden Bank gekennzeichnet. Es gab natürlich auch immer wieder Fusionen zwischen kleineren Privatbanken und auch zahlreiche Konkurse. Kunden kamen dabei praktisch nicht zu Schaden, da die Teilhaber der Banken alle unbeschränkt haftbar waren, wie heute in der Schweiz bei den noch wenigen Privatbanken. Im regulierten englischen Bankensystem war die Zahl der Konkurse relativ zur Gesamtzahl der Banken nicht etwa geringer, sondern mehr als doppelt so hoch wie in Schottland. Die Entwicklung in jener Zeit hat also gezeigt, dass ein Finanzsystem ohne Zentralbank stabiler ist.
Währungswettbewerb
Gab eine Bank zu viele auf ihren Namen lautende Noten in Umlauf, die nicht mehr ausreichend gedeckt waren, entzogen ihr die anderen Banken das Vertrauen, indem sie den Umtausch zu pari nicht mehr akzeptierten. So geschah dies z.B. beim damals spektakulären Konkurs der sogenannten Ayr Bank. Sie wurde 1769 gegründet und entfaltete eine sehr aggressive Geschäftspolitik, indem sie eine große Zahl schlechter Kredite durch eine ungezügelte Herausgabe von Noten finanzierte. Sie brach schon nach wenigen Jahren zusammen. Das ist ein treffendes Beispiel für den damals herrschenden Währungswettbewerb. Um einem Verlust des Vertrauens in Banknoten vorzubeugen, erklärten sich – einen Tag vor der Liquidation – die Bank of Scotland und die Royal Bank bereit, die Noten der Ayr Bank zu übernehmen. Sie konnten dies tun, weil die 241 unbeschränkt haftenden Teilhaber der Ayr Bank die Verluste übernehmen konnten. Das so gut funktionierende „free banking“ in Schottland wurde leider vom britischen Parlament mit den sog. „Peel’s Acts“ von 1844 und 1845 praktisch verunmöglicht, weil das englische Zentralbanksystem auch auf Schottland ausgedehnt wurde.
Im Unterschied zu damals haben heute die meisten Banken viele Kunden mit Sichteinlagen. Die Banken sind aber Aktiengesellschaften, deren Haftung beschränkt ist. Die Lösung für dieses Problem ist heute die Zentralbank als lender of last resort, d.h. die Banken können im Notfall nach staatlicher Hilfe ersuchen. Es gibt heute in einer modernen, liberalen Volkswirtschaft keine andere Branche mit diesem Privileg. Dies legt die Idee nahe, dass in unseren heutigen Marktwirtschaften „…die Organisation des Bankensystems einer sozialistischen Wirtschaft viel näher ist als einer Marktwirtschaft“, wie es der liberale spanische Ökonom Jesús Huerta de Soto sarkastisch ausdrückte.
Eine liberale Lösung wäre eine 100%-Deckung der Sichteinlagen. Sie wurde schon im 16. Jahrhundert von den spanischen Scholastikern diskutiert. Es waren dies Dominikaner und Jesuiten, die an den Universitäten von Salamanca und Coimbra lehrten. Sie können als die eigentlichen Vorläufer der Österreichischen Schule der Nationalökonomie angesehen werden. Ihr Einfluss schwand mit dem Niedergang Spaniens im 18. und 19. Jahrhundert, und die klassische englische Nationalökonomie begann ausgehend von Adam Smith ihre Vorherrschaft. Carl Menger (1840 – 1921), der gemeinhin als Gründer der Österreichischen Schule angesehen wird, kannte und zitierte aber die Werke der spanischen Gelehrten. Und wie Joseph A. Schumpeter nachgewiesen hat, übte ihr Denken auch erheblichen Einfluss auf Adam Smith aus.
Totalrevision des Bankwesens
Der spanische Ökonomieprofessor Jesús Huerta de Soto, ein prominenter Vertreter der Österreichischen Schule und Träger der Hayek-Medaille, schlägt daher eine totale Reform des Bankwesens vor. Er fordert 1) eine totale Wahlfreiheit der Währung, d.h. die Abschaffung gesetzlicher Zahlungsmittel, 2) ein System vollständiger Bankfreiheit und 3) eine hundertprozentige Reservepflicht für Sichteinlagen. Die dritte Bedingung widerspricht allerdings der vollständigen Bankfreiheit. Es kann ruhig den Banken überlassen bleiben, ob sie für sich etwa im Rahmen der allgemeinen Geschäftsbedingungen eine Volldeckung einführen wollen. Es dürfte sich bald herausstellen, dass diese Banken ein höheres Vertrauen genießen und damit konkurrenzfähiger wären als die anderen.
Das heutige System der Bankenregulierung durch eine Dienststelle für Bankenaufsicht und die Zentralbank würde überflüssig. Ein Konkurs einer Bank brächte für die Anleger keinen Schaden, weil ihre Einlagen nicht mehr zur Bilanz gehörten. Andere ungesetzliche Handlungen von Finanzdienstleistern wären durch die für alle wirtschaftlichen Tätigkeiten geltenden Rechtsvorschriften und die strafrechtlichen Normen erfasst. Der Staat könnte abspecken: Die Finanzmarktaufsicht beispielsweise in der Schweiz hat rund fünfhundert Mitarbeiter und selbst im kleinen Liechtenstein sind es etwa achtzig Personen! Das vorgeschlagene System würde bei einer gleichbleibenden Geldmenge wegen des Produktivitätsfortschritts zu einer leichten Deflation führen. Bei einem von Huerta de Soto vehement empfohlenen Goldstandard würde die Deflation wegen der leichten Zunahme der Goldmenge (die Goldminen bestehen und fördern ja weiter) teilweise kompensiert.
Leider herrscht allgemein, auch bei den Zentralbanken, die Ansicht vor, eine leichte Inflation von 2-5% sei wünschbar, etwa zur Erhaltung einer guten Beschäftigungslage, zur Förderung des Wachstums und zum Abbau der Schulden. Es sei nur wichtig, sie zu begrenzen. Eine solche Begrenzung wäre allerdings zu einem Zeitpunkt notwendig, wenn die Wirtschaft wieder in Fahrt kommt. Die EZB wäre dann politisch kaum in der Lage, sofort wieder die Bremse anzuziehen. Außerdem ist das Durchwursteln mit der Weiterführung der Liquiditätsschwemme allzu bequem. Daher sind die Aussichten für eine konsequente Reduktion der riesigen Staatsschulden und eine grundlegende Reform des Finanzwesens gegenwärtig leider nicht rosig.
Bildnachweis: fotolia / Antonio