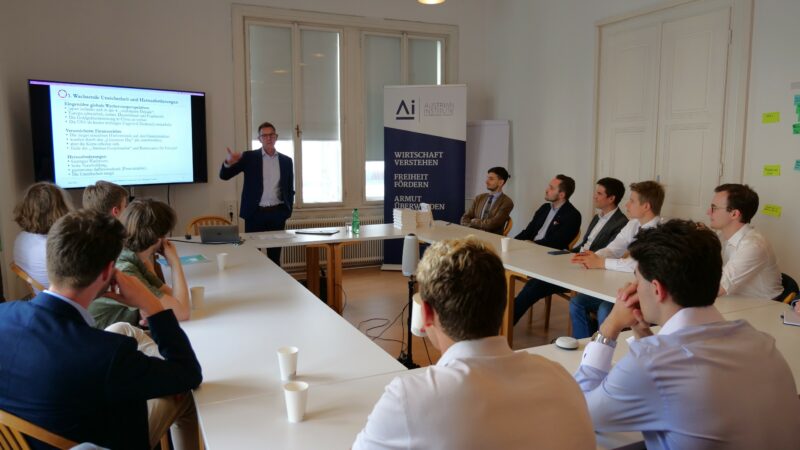Zeitgenössische Darstellung der Landsgemeinde Appenzell am Ende des 18. Jahrhunderts (Museum Appenzell, Schweiz). Die Landsgemeinde ist für viele der Inbegriff der direkten Demokratie. Besser versteht man sie jedoch als ergänzendes Korrektiv zum Parlamentarismus. (Bild: Wikimedia Commons)
Zeitgenössische Darstellung der Landsgemeinde Appenzell am Ende des 18. Jahrhunderts (Museum Appenzell, Schweiz). Die Landsgemeinde ist für viele der Inbegriff der direkten Demokratie. Besser versteht man sie jedoch als ergänzendes Korrektiv zum Parlamentarismus. (Bild: Wikimedia Commons) Das Thema Wechselspiel von Liberalismus und direkter Demokratie hat, obwohl man es kaum gleich merkt, auch mit Unternehmertum zu tun. Viele Unternehmer und Manager leiden nämlich an der Demokratie. In rund 40 Jahren zuerst bei der NZZ und dann bei dem von Unternehmen finanzierten Think Tank Avenir Suisse habe ich so manche Wirtschaftsführer kennengelernt.
Mehrheiten können versucht sein, sich eine fast absolute Macht anzumaßen. Solche Machtausübung durch demokratisch gewählte Institutionen kann für das Individuum ähnlich einschränkend sein wie Machtausübung durch einen Fürsten.
Wir sprachen nicht nur viel über ihre Unternehmen, sondern auch über Politik. Und ich übertreibe nicht: es gab keinen einzigen und keine einzige, die nicht an der Politik litten und wohl weiterhin leiden – und zwar nicht nur an den Regulierungen und Steuern. Sie leiden an der Demokratie generell, zumal an der direkten Demokratie. Sie leiden daran, dass es für kleinste Veränderungen unglaublichen Aufwand braucht, dass Emotionen und sachfremde Überlegungen dominieren, dass Kuhhändel die Norm sind, dass Initiativen und Referenden vieles verzögern, ja lähmen, kurz: sie leiden am Mangel an Führung. Man kann sagen: sie hadern desto mehr mit der Politik, je basisdemokratischer sie gestaltet ist.
In den 1980er Jahren, als ich mich mit Osteuropa und China beschäftigte, stellte ich bei Schweizer Managern gegenüber diesen Diktaturen einiges Wohlwollen fest – wegen der klaren Entscheide und der Stabilität. Entwicklungsdiktaturen wie Singapur genießen erst recht Sympathie. Manager bekommen glänzende Augen, wenn in solchen Ländern liberale Reformen erfolgen. Doch selbst wenn man ex post zum Schluss käme, man lebe in Singapur freier als in, sagen wir, Frankreich, darf man nicht folgern, die Freiheit sei in autoritären Regimen generell besser gesichert.
Verbreitet ist auch eine gewisse Bewunderung für repräsentative parlamentarische Systeme, in denen z.B. eine Bundeskanzlerin mit Richtlinienkompetenz und einer Mehrheit im Parlament, selbst wenn es nur eine Koalitionsmehrheit ist, durchregieren – also führen – kann.
Repräsentative Demokratie: Das „System Escher“ in Zürich
Unternehmer sind in ihren Unternehmen große Machtfülle gewohnt und haben mit hierarchischen Strukturen oft Erfolg. Sie fragen sich, warum es in der Politik anders sein sollte. Daher engagieren sie sich selten in der Politik, und wenn doch, halten sie es kaum lange aus. Ausnahmen wie Christoph Blocher bestätigen die Regel. Eine Ausnahme war auch Alfred Escher (1819 – 1882), jene Jahrhundertfigur, die dank dem Schweizer Historiker Joseph Jung in den letzten Jahrzehnten wieder die Beachtung erhielt, die ihr gebührt. Escher verkörpert Unternehmertum, Pioniergeist und wirtschaftlichen Aufbruch wie kein zweiter in den letzten 200 Jahren. Aber Escher war auch Politiker – und was für einer. Er saß 34 Jahre im Nationalrat, den er mehrmals präsidierte. Er saß für die liberale Partei, die wie die NZZ für die repräsentative Demokratie eintrat, im städtischen und im kantonalen Zürcher Parlament und er war Regierungsrat. Kein Wunder, dass auch viele staatliche Institutionen und Reformen seine Handschrift tragen.
Doch Escher warnte vor zu viel Demokratie. „Er vertrat“, ich zitiere Werner Wüthrich, „im Kanton und im Bund dezidiert die Meinung, dass regelmäßige Volksabstimmungen die politischen Abläufe verlangsamen und den Fortschritt behindern würden und der Sachverstand beim einfachen Volk fehle. Und er hielt sein Leben lang an dieser Meinung fest.“ Ihm behagte die Machtfülle, mit der er zumindest im Kanton Zürich schalten und walten konnte, wie er wollte.
Aber obwohl Escher in den Ämtern stets bestätigt wurde, wuchs die Opposition gegen das System Escher. Die Stimmbevölkerung des Kantons Zürich sagte am 18. April 1869 mit 65% Ja zu einer direktdemokratischen Verfassung. An den darauf folgenden Wahlen wurden die bis dahin dominierenden Liberalen von den Demokraten hinweggefegt, im Kantons- und Regierungsrat wie in der Zürcher National- und Ständeratsvertretung in Bern. Escher selbst wurde allerdings mit hervorragendem Resultat wieder in den Nationalrat gewählt. Mit der Zeit näherten sich die beiden Parteien an, sodass daraus die FDP entstand, die Freisinnig-Demokratische Partei. Ganz beseitigt ist die Spannung aber nicht.
Das Spannungsfeld zwischen Liberalismus und Demokratie
Demokratie und Liberalismus decken sich weniger, als oft behauptet wird, sie widersprechen sich zum Teil sogar. Gemäß dem Sozialphilosophen Friedrich August von Hayek sieht „der Liberalismus … die Hauptaufgabe in der Beschränkung der Zwangsgewalt jeder Regierung, sei sie demokratisch oder nicht; der dogmatische Demokrat dagegen kennt nur eine Beschränkung der Staatsgewalt und das ist die Meinung der jeweiligen Majorität. … Das Gegenteil der Demokratie ist eine autoritäre Regierung; das Gegenteil eines liberalen Systems ist ein totalitäres System. … Eine Demokratie kann totalitäre Gewalt ausüben und es ist vorstellbar, dass eine autoritäre Regierung nach liberalen Grundsätzen handelt“. Und an anderer Stelle: „ … so muss ich offen zugeben, dass ich, wenn Demokratie heißen soll: Herrschaft des unbeschränkten Willens der Mehrheit, kein Demokrat bin“. Die Formulierung ist nicht falsch, aber sie lädt zu – oft mutwilligen – Fehlinterpretationen ein. Es heißt dann, man sehe daran, wie demokratiefeindlich und autoritätsfreundlich die Liberalen seien. Das sind Liberale nicht, erst recht nicht, wenn es um die direkte Demokratie geht. Von allen Arten der Demokratie passt sie am besten zum Liberalismus.
Es war der Liberalismus, nicht die repräsentative Demokratie
Joseph Jung solidarisiert sich in seinem Opus Magnum „Das Laboratorium des Fortschritts“ über die Zeit des Aufbruchs im 19. Jahrhundert in der Frage „repräsentative oder direkte Demokratie?“ stark mit Escher, hat also, zumindest für die Mitte des 19. Jahrhunderts, mehr Sympathie für die repräsentative Demokratie. Warum? Dem großen Befreiungsschlag durch die Bundesverfassung von 1848 lag die repräsentative und nicht die direkte Demokratie zugrunde. Allein eine so stark reduzierte Demokratie war im Urteil Jungs in der Lage „der Wucht der Modernisierungswellen in den 1850er/60er Jahren standzuhalten. Die direkte Demokratie wäre das falsche Rezept gewesen und hätte die Erfolgsgeschichte des jungen Bundesstaats verunmöglicht. Für eine nach Parteien und Interessenverbänden austarierte Schweiz war die Zeit Mitte des 19. Jahrhunderts noch nicht gekommen.“
So viel uns sonst verbindet, haben sich Joseph Jung und ich über diese Frage oft – vorsichtig gesagt – kontrovers unterhalten. Es scheint, dass wir hier das Heu nicht auf der gleichen Bühne haben – oder vielleicht doch? Ich maße mir nicht an, sein Urteil in Zweifel zu ziehen. Es mag so sein, wie er schreibt. Doch ex post festzustellen, dass das Modernisierungswerk dank „Entscheidungswegen, wie sie ab dem letzten Viertel des 19. Jahrhunderts in der direkten Demokratie nicht mehr gangbar waren“, gelungen ist, heißt nicht, dass man ex ante der repräsentativen gegenüber der direkten Demokratie den Vorzug hätte geben sollen. Und aus der Beobachtung der Vergangenheit lassen sich kaum Normen für die Zukunft ableiten. Jung nimmt selbst eine Relativierung vor und schreibt, die Zeit für die direkte Demokratie sei damals noch nicht reif gewesen.
Es gibt keinen Grund, der ex ante vermuten ließe, in der repräsentativen Demokratie gebe es systematisch mehr Freiheit und weniger schleichenden Etatismus.
Entscheidend ist, dass es bei der repräsentativen Demokratie mehr auf das politische Personal ankommt als bei der direkten Demokratie. Die größere Macht an der Spitze verschafft den herrschenden Mehrheiten zwar die Chance, liberale Reformen durchzusetzen. Das fasziniert jene, die dem Mythos stärkerer politischer Führung anhängen. Ob aber die auf Mehrheiten oder Koalitionen basierenden Regierungen diese Chance auch im liberalen Sinne nutzen, ist offen. Es gibt keinen Grund, der ex ante vermuten ließe, in der repräsentativen Demokratie gebe es systematisch mehr Freiheit und weniger schleichenden Etatismus. Das heißt: wäre der repräsentativ-demokratische Bundesstaat nicht von wirtschaftsliberalen Persönlichkeiten wie Alfred Escher geprägt worden, sondern von Konservativen und Etatisten, hätte es das Swiss Miracle, wie es Jung nennt, vielleicht nie gegeben.
Jung scheint heute dieser Sichtweise selbst zuzuneigen: „Diese einzig richtige Rezeptur im jungen Bundesstaat hatte ihre Wirkung nur entfalten können, weil die Wirtschaftsliberalen die Mehrheiten hatten und über exzellente Führungspersönlichkeiten verfügten. Wären die Mehrheiten in diesem historischen Zeitfenster konservativ oder sozialistisch gewesen, wäre die repräsentative Demokratie für das Land zur Katastrophe geworden.“ Die repräsentative Demokratie war also deswegen erfolgreich, weil in ihr Liberale dominierten. Ich würde sogar noch weiter gehen und die These wagen, starke liberale Politiker hätten selbst in einer direkteren Demokratie als jener der Bundesverfassung von 1848 ein Befreiungswerk zustande gebracht.
Direkte Demokratie: Antikritische Sicherung
Natürlich ist die direkte bzw. halbdirekte Demokratie keine perfekte Form der Entscheidung im Kollektiv. Nicht immer hat die Volksmehrheit recht, weder bei Abstimmungen noch bei Wahlen. Ferner kann es den Wert der Abstimmungen unterminieren, wenn es zu viele davon gibt. Kritik ist also zum Teil angebracht.
Mit mehr Entscheidungskompetenz ausgestattete Regierungen, Parlamente und oberste Gerichtshöfe sind keine Garanten für durchgehend oder auch nur öfter freiheitssichernde Gesetze und Urteile…. Schwarmintelligenz kann mit der Kompetenz von Volksvertretern und Experten mithalten, wenn sie sie nicht sogar schlägt.
Zwei häufig gegen die direkte Demokratie erhobene Vorwürfe sind dagegen fragwürdig. Der eine Einwand lautet, direkte Demokratie verstärke die jeder Demokratie innewohnenden illiberalen Tendenzen. Es ist zwar richtig, dass Volksentscheide die Rechtsstaatlichkeit und die Rechtssicherheit gefährden können. Aber mit mehr Entscheidungskompetenz ausgestattete Regierungen, Parlamente und oberste Gerichtshöfe sind keine Garanten für durchgehend oder auch nur öfter freiheitssichernde Gesetze und Urteile. Die empirische Evidenz gibt das jedenfalls nicht her, und die Schweiz gilt auch nach der Rettungsaktion für die Credit Suisse noch immer als Hort der Stabilität und nimmt in internationalen Ranglisten der wirtschaftlichen und politischen Freiheit sowie der Wettbewerbsfähigkeit seit Jahren Spitzenplätze ein.
Der andere Einwand lautet, das Volk sei nicht in der Lage, komplexe Themen sachgerecht zu beurteilen. Auch er wird durch die schweizerische Realität widerlegt. Zwar kommt es zu Entscheiden, die eine Mehrheit von Experten für falsch halten, die internationalen Mehrheitsmeinungen widersprechen oder die im Rückblick von der Mehrheit des einst zustimmenden Volkes als Irrtum angesehen werden. Aber ist das in parlamentarischen Systemen anders? Das Schweizer Volk macht nicht mehr Fehler als die Parlamente der Nachbarländer und ist, trotz einiger irritierender Abstimmungen der letzten Zeit, insgesamt erstaunlich wirtschaftsfreundlich. Schwarmintelligenz kann mit der Kompetenz von Volksvertretern und Experten mithalten, wenn sie sie nicht sogar schlägt. Seit dem Zweiten Weltkrieg – davor und während diesem ohnehin – hat die Schweiz mit ihrem System nicht gröbere Dummheiten begangen als die Nachbarn, und sie war nicht stilloser oder unanständiger.
Notwendige Einhegung der direkten Demokratie
Selbst die beste direkte Demokratie muss aber begrenzt sein. Dass Entscheide demokratisch zustande kommen, adelt nicht per se deren Inhalte. Demokratien produzieren oft illiberale Resultate. In feudalen Ordnungen konnte die Bevölkerung ihre Freiheitsrechte nur gewinnen, indem sie die Macht der Herrschenden beschränkte. Staatsskepsis war Programm. Die Einführung der Demokratie nährte dann die Illusion, nun brauche es keine Beschränkung der staatlichen Macht mehr; die Zustimmung der Mehrheit sei Machtkontrolle genug.
Doch auf die Mehrheit ist als Schranke der Macht kein Verlass. Mehrheiten können versucht sein, sich abgesehen vom Schutz einiger Grundrechte eine fast absolute Macht anzumaßen. Solche Machtausübung durch demokratisch gewählte Institutionen kann für das Individuum ähnlich einschränkend sein wie Machtausübung durch einen Fürsten. Daher darf die Begrenzung der Demokratie niemals in einer Ausweitung der Macht der Eliten und Parlamente liegen. Das wäre nicht die von den Liberalen gewollte Begrenzung von Macht, sondern eine Verschiebung der Macht vom Volk, das diese Macht einst den Fürsten abgerungen hat, zu den Volksvertretern.
Da Abgeordnete praktisch nicht zur Rechenschaft gezogen werden, wird das liberale Prinzip der Haftung ausgehebelt. Das spricht für die direkte Demokratie als kleinerem Übel und für die sachliche und räumliche Beschränkung demokratischer Kompetenzen.
Ein Grundproblem kollektiver Entscheide, sofern sie nicht Einstimmigkeit verlangen, ist das Auseinanderfallen von Entscheidungskompetenz und Verantwortung. Wenn knappe Volksmehrheiten einen Entscheid treffen, der sich als nachteilig herausstellt, und zwar nachteilig für alle, tragen diese Mehrheiten nicht allein die Konsequenzen. Die unterlegene Hälfte trägt die Hälfte des Schadens. Erst recht gilt das, wenn der Volksentscheid fast nur die unterlegene Minderheit belastet. Bei repräsentativer Demokratie ist es noch gravierender. Parlamente können an der Mehrheit vorbeiregieren und so sogar die Mehrheit eines Volkes belasten. Da Abgeordnete praktisch nicht zur Rechenschaft gezogen werden, wird das liberale Prinzip der Haftung ausgehebelt. Das spricht für die direkte Demokratie als kleinerem Übel und für die sachliche und räumliche Beschränkung demokratischer Kompetenzen.
Längst nicht alles, was heute demokratisch entschieden wird, gehört in die öffentliche Domäne. Alle Demokratien, auch die Schweiz, sündigen hier. Und längst nicht alles, was kantonal, eidgenössisch oder europäisch geregelt wird, müsste auf dieser Ebene geregelt werden. Als Gegenstück zur sachlichen und geographischen Begrenzung empfiehlt es sich, jede Demokratie, auch die direkte, durch Selbstbindungen und autonome Institutionen, die der Demokratie weitgehend entzogen sind, einzuhegen. Für ersteres sind Schuldenbremsen ein Beispiel, für letzteres Notenbanken.
Vorteil: Resilienz gegenüber „schlechtem Personal“
Der Aufbruch von 1848 zeigt, dass liberale Ordnungspolitik ohne direkte Demokratie möglich ist. Zumal nach Kriegen und Krisen können liberale Köpfe ein marktwirtschaftliches Programm sogar besser in einer repräsentativen Demokratie durchziehen. Ein Beispiel sind die Wirtschaftsreformen Ludwig Erhards nach dem Zweiten Weltkrieg, als in Deutschland die Besatzungsmächte das Sagen hatten. Weil Freiheit unteilbar ist, braucht es für eine liberale Gesellschaft aber auch politische Partizipation. Kein System gewährt sie so sehr wie die direkte Demokratie. Trotzdem ist sie nicht hinreichend. Sie kann illiberale Gesetze erlassen oder in eine dogmatische Demokratie kippen. Ideal wäre daher, wenn es liberalen Persönlichkeiten gäbe, die es verstehen, in der direkten Demokratie Mehrheiten für die Freiheit zu gewinnen.
Politische Ordnungen müssen gegenüber Abweichungen vom Ideal möglichst robust sein. Das ist die direkte Demokratie insofern, als sie weniger von der moralischen und intellektuellen Qualität des Führungspersonals abhängt.
Doch Ideale sind nicht die Realität. Politische Ordnungen müssen gegenüber Abweichungen vom Ideal möglichst robust sein. Das ist die direkte Demokratie insofern, als sie weniger von der moralischen und intellektuellen Qualität des Führungspersonals abhängt. Böse Zungen behaupten ja, der Bundesrat sei die schwächste Regierung der Welt, aber das Land ist trotzdem seit Jahrzehnten relativ erfolgreich unterwegs und in den Rankings weit vorne. Das kann nur heißen, dass die Führung durch Regierung und Parlament in einer direkten Demokratie nicht sehr wichtig ist.
Für Krisen, in denen rasche Entscheide nötig sind, kann man eine temporäre Führung außerhalb des Bundesrates suchen, wie im Krieg einen General. Sonst aber fährt die Schweiz seit 1874 mit ihrem Vertrauen in die „Weisheit der vielen“ nicht schlecht. Neben der liberalen, normativen Begründung für die direkte Demokratie gibt es also eine resultatorientierte: Die direkte Demokratie hat sich mit Blick auf das Zieldreieck Freiheit, Glück und Wohlstand bewährt. Das ist Grund genug, sie zu hegen, zu pflegen und durch kluge Reformen zu bewahren.
Vortrag vom 3. 7. 2023 vor dem Verein für wirtschaftshistorische Studien, Zürich. Eine gekürzte Fassung dieses Textes ist unter dem gleichen Titel in der Neuen Zürcher Zeitung vom 24. Juli 2023 auf S. 19 erschienen, online hier. Eine ausgearbeitete und dokumentierte Fassung ist erschienen in Lukas Gschwend/ Gerhard Schwarz/ Clemens Fässler (Hrsg.), Spirit of ´48. Ehrengabe für Joseph Jung, Sonderpublikation des Vereins für wirtschaftshistorische Studien, Zürich 2023.
Im Text erwähnte Literatur:
Joseph Jung, Alfred Escher 1819 – 1882. Aufstieg, Macht, Tragik, 6. Aufl., Verlag Neue Zürcher Zeitung NZZ Libro, Zürich 2017.
Joseph Jung, Das Laboratorium des Fortschritts. Die Schweiz im 19. Jahrhundert, 2. Aufl., NZZ Libro, Zürich 2020.
Werner Wüthrich, Wirtschaft und direkte Demokratie in der Schweiz. Geschichte der freiheitlich-demokratischen Wirtschaftsverfassung der Schweiz, Verlag Zeit-Fragen, Zürich 2020.
Friedrich August von Hayek, Die Verfassung der Freiheit, 2. durchgesehene Auflage, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1983.
Friedrich August von Hayek, Recht, Gesetzgebung und Freiheit, Verlag Moderne Industrie, Landsberg am Lech 1981, Bd. 3.