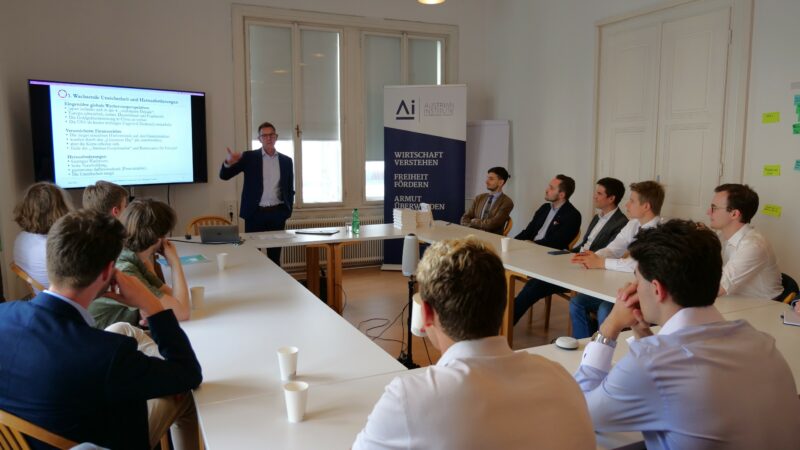Wird die EU zusammen mit dem Euro untergehen? Noch scheint es nicht zu spät, die Notbremse zu ziehen. (Bild: fotolia/mekcar)
Wird die EU zusammen mit dem Euro untergehen? Noch scheint es nicht zu spät, die Notbremse zu ziehen. (Bild: fotolia/mekcar) Bei der Einführung des Euro wurden wesentliche Fragen nicht ernsthaft besprochen, kritisiert der Ökonom Jörg Guido Hülsmann im Interview mit dem „Austrian Institute“. Diese Nachlässigkeit rächt sich spätestens seit dem Ausbruch der Finanzkrise. Hülsmanns Kritik an der gegenwärtigen Währungsordnung reicht aber noch weiter: Im Gegensatz zu anderen Ökonomen scheut er auch nicht davor zurück, das staatliche Geldmonopol und die permanent betriebene Inflation in Frage zu stellen. Gegenüber dem „Austrian Institute“ erläutert er, warum eine Umstellung der Währungsordnung schwierig, aber langfristig wünschenswert ist. Am Ende geht der Mises-Experte auch auf die Bedeutung der Österreichischen Schule der Nationalökonomie ein.
Austrian Institute: „Zehn Jahre Euro, zehn Jahre Erfolgsgeschichte“, titelten 2010 sämtliche deutsche Medien. Mittlerweile ist mehr Zurückhaltung eingekehrt. Wie ist Ihr Resümee nach 18 Jahren Euro?
Jörg Guido Hülsmann: Dass sich alle Befürchtungen, die vor Einführung des Euro vorgebracht wurden, bewahrheitet haben: Der Euro wurde zum Zankapfel, der die Europäer entzweit. Auch Nicht-Ökonomen wie Arnulf Baring äußerten in den 1990er Jahren diese Sorge. Ludwig von Mises brachte im Jahr 1918 ähnliche Gedanken bezüglich der damals vorgeschlagenen aber nie vollzogenen Währungsunion zwischen dem Deutschen Reich und Deutschösterreich vor: Bei einer solchen Union muss man sich darüber einigen, wie weit die Geldmenge ausgeweitet wird und wer wie viel davon kriegt. Diese Fragen wurden bei der Einführung des Euro nie ernsthaft diskutiert. Man dachte, wenn man nur Marktkriterien anlegt, wird sich alles von selbst dem Bedarf entsprechend entwickeln. Das war nicht der Fall, wie wir nach der Finanzkrise gesehen haben: Die Rettung Griechenlands wurde unter Verletzung aller Regeln beschlossen. Ein neues Kriterium, das bis dahin nirgendwo festgehalten war, wurde aufgestellt, nämlich die Kohäsion – also der Zusammenhalt – der Euro-Zone. Man hat das so ausgelegt, dass man alle im Boot halten muss, selbst wenn wir mit der Notenpresse einige Länder systematisch subventionieren auf Kosten der anderen Länder.
Jörg Guido Hülsmann, Jahrgang 1966, lehrt an der Fakultät für Recht, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften der Universität Angers und ist darüber hinaus Senior Fellow am Ludwig von Mises Institute in Auburn (Alabama). In seinen Büchern „Ethik der Geldproduktion“ und „Krise der Inflationskultur“ beschäftigt er sich mit grundsätzlichen Fragen und Problemen der Geldordnung. Mit „Mises: The Last Knight of Liberalism“ verfasste er die zurzeit maßgebliche Mises-Biographie.
Vor Einführung des Euro waren andererseits die internationale Arbeitsteilung und der internationale Handel innerhalb Europas nicht so stark ausgeprägt. Konnte hier eine gemeinsame Währung nachhelfen?
Wir haben von vielen günstigen Entwicklungen profitiert. Die stärkere wirtschaftliche Integration, der freie Warenhandel und der freie Kapitalverkehr waren sicher hilfreich. Beim freien Personenverkehr bin ich schon skeptischer, und bei der Währungsunion bin ich schon immer skeptisch gewesen. Die Schwere des Arguments von Baring und Mises ist mir erst nach und nach bewusst geworden. Mein Einwand in den 1990er Jahren war: Die gemeinsame Währung erleichtert das Schuldenmachen und diszipliniert niemanden. Deshalb rechnete ich mit noch mehr Schulden und damit, dass die Wirtschaft überall – nicht nur in traditionellen Schwachwährungsländern – auf schwächerem Fundament stehen wird.
Für wie stabil halten Sie den Euro heute?
Für sehr stabil, solange er die politische Rückendeckung Deutschlands hat. Wenn die Deutschen abspringen, bricht der Euro zusammen. Wenn Italien aussteigt, wäre es ein Schock, aber der Euro würde vermutlich überleben.
Es hätte aber weitreichende Konsequenzen: Sämtliche italienische Banken wären betroffen mit kaum abschätzbaren Dominoeffekten. Die Politik muss dieses Szenario fürchten.
Die italienische Regierung wird sich die Folgen vermutlich noch genau erklären lassen und am Ende dieselbe Entscheidung treffen wie die griechische Regierung Alexis Tsipras. Auch die wollte ursprünglich unbedingt den Euro und möglicherweise sogar die EU verlassen, doch nachdem sie sich die Konsequenzen genau durchgerechnet hat, beschloss sie, ihrer Bevölkerung diese Rosskur nicht anzutun. Nichts anderes wäre auch ein Euro-Ausstieg für Italien. Auf kurze Sicht wäre er für die Italiener sicher deutlich dramatischer als für andere Länder. Ich bestreite nicht, dass Italiens Austritt langfristig sinnvoll ist. Ganz im Gegenteil! Aber heutzutage werden Entscheidungen nur kurzfristig gefällt und ich glaube nicht, dass Italien diese Krise nach vier Jahren überwunden hätte. Die langfristigen Früchte dieser Entscheidung würde erst die nächste Regierung ernten.
Eine „atmende Währungsunion“, wie sie der deutsche Ökonom Hans-Werner Sinn vorschlägt, in der einzelne Länder je nach dem Zustand ihrer Volkswirtschaft der Eurozone beitreten und sie wieder verlassen können, wäre demnach ökonomisch sinnvoll, aber politisch schwer durchsetzbar.
Ja.
Zu den Befürwortern des Euro zählt Ihr spanischer Kollege Jesús Huerta de Soto.
Sein Argument ist richtig, nur seine Perspektive ist anders als meine: Er ist Spanier und ich bin Deutscher. Für die Spanier ist der Euro besser als ihre frühere Währung. Die gemeinsame Währungspolitik nimmt der spanischen Regierung die Möglichkeit, sich aus der Verantwortung für einen ausgeglichenen Staatshaushalt auf sehr einfache Weise zurückzuziehen. Insofern diszipliniert der Euro den spanischen Staatshaushalt. Aber in Deutschland war das schon ohne Euro der Fall. Uns hat der Euro nur geringfügige Vorteile, gleichzeitig aber sehr große Nachteile gebracht. Man denke etwa an die versteckte Umverteilung über die Target-2-Salden.
Für Spanier und Italiener bedeutet der Euro aber einen Mentalitätswandel.
Natürlich. Wir gehen von ganz unterschiedlichen Voraussetzungen aus. Für die Deutschen war immer klar: Man soll die Notenpresse nicht dafür missbrauchen, Projekte der Regierung zu finanzieren. Deutschland hatte erst ab Otto von Bismarck eine Zentralbank. Der einzige Weg das Reich zusammenzuführen, ohne dabei den Ausbruch von Rivalitäten innerhalb des Reichs zu provozieren, war, die Nationalbank darauf zu verpflichten, keinerlei Staatsfinanzierung durchzuführen. In der Habsburger-Monarchie war das ähnlich: Die Zentralbank hätte nie eine Politik betreiben können, bei der sie nur einzelne zentrale Regionen bezuschusst. In Frankreich, Spanien und England ist es hingegen eine jahrhundertealte Tradition über die Nationalbank den Staat zu finanzieren. Die Bank of England wurde mit dem kurzfristigen Hauptziel gegründet, die Krone zu finanzieren.
Sie kritisieren nicht nur den Euro, sondern auch das gesetzliche Geldmonopol des Staats. Damit vertreten sie eine Randposition im ökonomischen Meinungsspektrum. Ihr Einwand ist sowohl ökonomisch, als auch moralisch motiviert.
Der staatliche Zwang wird dazu verwendet, die Geldmenge stärker auszuweiten als es unter Marktbedingungen möglich wäre. Eine Ausweitung der Geldmenge bewirkt zwangsläufig Umverteilung, zu deren Nutznießern der Staat gehört sowie all jene, die zuerst in den Genuss der neuen Geldeinheiten gelangen, also Geschäftsbanken und Finanzmarkt-nahe Institutionen. Die Verlierer sind alle Finanzmarkt-fern. Diese Umverteilung ist heimtückisch, weil sie als solche nicht erkannt wird, und immer noch von vielen Ökonomen abgestritten wird, vor allem von jenen, die in Zentralbanken arbeiten. Es gibt darüber keinen Mehrheitsbeschluss. Bei den alljährlichen Streits um den Jahreshaushalt wird um jede Million gefeilscht, gleichzeitig weitet die Europäische Zentralbank die Grundgeldmenge und die Geldmenge M3 jedes Jahr um 500 Milliarden Euro aus – ohne irgendeine Diskussion darüber.
Vermutlich will die EZB so die Inflation in Deutschland anheben.
Da stehe ich aus rein ökonomischen Erwägungen auf dem Boden der klassischen Ökonomen und der Österreichischen Schule, die eine Preisinflation nie für wünschenswert gehalten hat. In den glorreichen Tagen der deutschen und österreichischen Wirtschaftsgeschichte – im Wesentlichen zwischen 1870 und dem Ersten Weltkrieg – hatten wir das stärkste Wirtschaftswachstum und gleichzeitig Preisdeflation.
Die von Ihnen kritisierte Inflationskultur prägt die gesamte Gesellschaft. Ein sofortiger Umstieg auf Deflation würde einige Gesellschaftsschichten beinhart treffen.
Sicher. Abgesehen vom Geschäftsleben sind auch sämtliche andere Bereiche wie die persönliche und staatliche Haushaltsführung komplett auf ein preisinflationäres Umfeld abgestellt. Sie führt unter anderem zu Schuldenfinanzierung, zur Nicht-Einhaltung von Budgets und zu Abhängigkeiten, weil Unternehmen angestoßen werden, die eigentlich nicht auf eigenen Füßen stehen, sondern nur wegen Zuschüssen bestehen. In meinem Buch „Krise der Inflationskultur“ habe ich mehrere kulturelle Phänomene erwähnt, darunter auch die Hast, die das moderne Wirtschafts- und Gesellschaftsleben kennzeichnet. Für Stefan Zweig ist diese neue Hast Kennzeichen der Zwischenkriegszeit. Er hat das in seinem wunderschönen Buch „Die Welt von Gestern“ beschrieben. Der ökonomische Grund ist: Je früher man eine Ressource in einem preisinflationären Umfeld benutzen kann, desto größer sind die Vorteile, weil man von dem Mehrwert profitiert.
Wie soll jemand heute sein Geld anlegen, wenn er eine große Geldmenge erbt?
Ein Sparbuch wäre wirtschaftlicher Selbstmord. Streng genommen gibt es aber nur zwei Möglichkeiten: Immobilienbesitz oder Aktien. Gold ist auch eine Option. Freilich ist es der Feind aller Nationalbanken, wie der frühere Vorsitzende der Federal Reserve Paul Volcker einmal offen zugegeben hat. Als natürliches Geld ist Gold nämlich der natürliche Feind aller Papierwährungen. Langfristig liegt man daher immer richtig, wenn man in Gold und Silber investiert. Allerdings hängt das vom Alter des Investors ab: Wer 50 oder 60 Jahre alt ist, sollte eher nicht in Gold investieren. Alle 20 oder 30 Jahre kommt es zu größeren Durchbrüchen beim Goldpreis.
Seit dem 17. Jahrhundert wuchs die enge Partnerschaft zwischen Banken und Staaten. Gleichzeitig erlebten wir in den vergangenen 250 Jahren ein historisch beispielloses Wirtschafts- und Wohlstandswachstum. Ausgerechnet zur Zeit eines beispiellosen Wohlstands leben wir in einer besonders schlecht Geldordnung. Das erscheint doch als widersprüchlich.
Wir profitieren heute von Umständen, die nichts mit der Geldordnung zu tun haben. Man denke nur an den Fortschritt in Informationstechnologie und Biologie usw. Gleichzeitig erlebten wir mit dem Zusammenbruch des Kommunismus eine ungeheure Ausweitung der internationalen Arbeitsteilung. Unter solchen Umständen hätten wir in früheren Zeiten zweistellige Wachstumsraten gehabt. Das ist aber nicht der Fall. Die positiven Einflüsse werden von negativen konterkariert, und diese kommen meines Erachtens weitgehend aus dem momentanen Währungssystem, das den Kapitalverzehr in großem Umfang erleichtert. Vor dem 17. Jahrhundert herrschten keine paradiesischen Zustände. Es gab ebenfalls Inflation, allerdings über Münzverschlechterung. Glorreiche Momente der europäischen Währungsgeschichte gab es zum Beispiel im 19. Jahrhundert in Frankreich und im Deutschen Reich. Es gab einen großen und effektiven Gold- und Silberumlauf. Die Bevölkerung war es gewohnt, Gold- und Silbermünzen von guter Qualität zu verwenden. Auch in Städterepubliken wie Hamburg, Amsterdam oder in den italienischen Kommerzrepubliken war das früher teilweise so. Gerade in den Städten mit republikanischer Verfassung wurden Regierungen gewählt, die Garantien für die Sicherheit dieser Währungen boten. In der Verfassung der Amsterdamer Bank wurde die ausreichende Silberdeckung verordnet. Solche Phasen zeigen uns, wie gut die Dinge auch heute funktionieren könnten, wären solche Voraussetzungen gegeben.
Durch die Blockchain-Technologie geriet die Idee des Währungswettbewerbs wieder in aller Munde. Nun unterstreichen Sie ja, dass Edelmetalle auch deshalb so gute Währungen sind, weil sie im Gegensatz zu Papiergeld auch einen nicht-monetären Wert haben. Bitcoin und andere Blockchain-basierte Währungen unterscheiden sich in dieser Hinsicht freilich auch nicht vom Papiergeld. Können daraus gute Währungen entstehen?
Zurzeit sind es noch keine Währungen. Geld ist per definitionem ein allgemein verwendetes Tauschmittel. Zwar könnte man Bitcoin eventuell als Tauschmittel bezeichnen, allerdings sind das dann auch Google- und Apple-Aktien. Doch obwohl dort der Markt sogar größer ist, würden wir bei Apple- und Google-Aktien nicht von Geldarten sprechen. Die Schöpfer von Bitcoin wollten zwar eine virtuelle Geldart schaffen, doch zurzeit ist es eher ein virtuelles Gut, das aber – und da bin ich auf der Seite der Bitcoin-Befürworter – sehr wohl eine Art „inneren Wert“ hat, da es bestimmte Nutzen und Dienste verschafft, speziell in Ländern mit drakonischen Kapitalverkehrskontrollen. Hier hat Bitcoin echte Vorteile, die Gold zum Beispiel nicht hat. Die Blockchain-Technologie, auf der Bitcoin basiert, erscheint mir als interessant und potenziell revolutionär, vollkommen unabhängig von Bitcoin. Zum Beispiel könnte man auch eine Blockchain-basierte Goldwährung in Umlauf bringen.
Das wäre dann eine Art neuer Goldstandard?
Ja. Man hätte halt eine hundertprozentige Deckung als konstitutives Element. Und man kann noch mehr mit Blockchain machen. Denken Sie etwa an den Wertpapierbesitz. Die Art, wie Wertpapiere heute gehandelt werden, basiert auf einem System, das Anfang der 1970er Jahren geschaffen wurde. Seit damals werden alle Aktien in den USA – in Deutschland und Frankreich schon davor – zentral gehalten; der nominelle Eigentümer bekommt sie nicht mehr zu Gesicht, wie es davor noch üblich war. Der Grund war: Der Börsenumsatz wurde so hoch, dass die Juristen mit ihrer Arbeit nicht mehr hinterherkamen und es nicht schafften, die Einträge in das Aktionärsregister zeitnah vorzunehmen. Mit Blockchain könnte man dieses Problem sehr elegant lösen. Ohne zentrale Stelle könnte man eine Blockchain-basierte Eigentümerschaft ermöglichen, die durch Tausch weitergereicht wird. Letztlich verschiebt sich natürlich das Grundproblem: Wer ist der Wächter? In dem Moment, wo man Blockchain nicht auf rein virtuelle Objekte wie Bitcoin anwendet, sondern auch auf Immobilien und Wertpapiere, muss jemand sicherstellen, dass hier kein Betrug stattfindet.
Eine Währungsreform bleibt weiterhin schwer umzusetzen.
Alles, was uns in Richtung einer besseren Währungsordnung bringt, geht unmittelbar mit einer fürchterlichen Wirtschaftskrise einher. Das liegt daran, dass große Teile der Finanzmärkte von billigen Krediten aus der Notenpresse wie Drogensüchtige abhängen. Das bedeutet erst mal einen Kalten Entzug. Wenn darüber hinaus so viel mit Kredit operiert wird wie heute, dann braucht man Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte in einem Umfang, den Sie in einer eigenkapitalbasierten Gesellschaft nicht hätten. Große Teile gerade solcher Intellektuellen-Berufe wären davon betroffen.
Sie haben in den 1990er Jahren den Währungswettbewerb, wie ihn Friedrich August von Hayek in „Entnationalisierung des Geldes“ vorgeschlagen hat, kritisiert. Was ist Ihr Einwand?
Die Art, wie sich Hayek die Einführung des neuen Geldes vorstellt, ist problematisch: Er würde Dukaten auf den Markt bringen, die man zu einem festen Wechselkurs gegen Dollar einlösen könnte. Irgendwann müsste man dann dieses Versprechen aufheben. Ein Vertragsbruch soll Ursprung für ein Marktgeschehen sein? Das halte ich für das Hauptproblem. Hayek hat gesehen: Um einem Gut Wert zu verleihen, muss vorher ein Versprechen gegeben werden. Damit daraus ein eigenständiges Gut wird – also nicht mehr nur ein Schuldtitel – muss man das Versprechen zurückziehen beziehungsweise das Vertragsrecht brechen, was allerdings nur mit Rückendeckung der Regierung möglich ist.
Eine rein immaterielle Währung hat keinen inneren Wert. Wie sieht das dann aus, wenn der Wechselkurs relativ zu anderen Währungen abschmiert, speziell zu Gold und Silber? Dann gibt es keinen Haltepunkt mehr, im Gegensatz zu Gold und Silber, wo es immer einen Haltepunkt gibt. Weil es auch nicht-monetäre Verwendungen von Gold und Silber gibt, können dort der Wert und der Wechselkurs nicht auf null fallen. Bei virtuellen Währungen ist das anders. Das waren damals meine Einwände.
Sie stützen sich als Wissenschaftler vor allem auf Mises und Murray Rothbard. Was zeichnet die beiden aus?
Ich denke, Rothbard hat 1962 mit „Man, Economy, and State“ tatsächlich das auch heute noch beste Lehrbuch der Wirtschaftstheorie geschrieben. Nur sehr selten kann man das noch nach so vielen Jahrzehnten über ein Lehrbuch sagen. Der Grund liegt darin, dass sich die neoklassische Wirtschaftstheorie in ihren Grundfesten seither nicht verändert hat. Die Theorien, die Rothbard damals kritisiert bzw. gegenüber denen er eine realistische Herangehensweise gewählt hat, werden heute immer noch gelehrt. Die Grundelemente in Paul A. Samuelsons „Volkswirtschaftslehre“ finden Sie auch heute noch in den Lehrbüchern für die ersten drei Jahre Ökonomie. Deshalb sind Rothbard und selbst Mises noch immer aktuell. Ausgerechnet John Maynard Keynes, der sich immer über die herrschende ökonomische Orthodoxie mokiert hat, hat selbst die längst anhaltende Orthodoxie in der Volkswirtschaftslehre geschaffen. Kritiker von damals sind noch immer up to date.
Die Neoklassik besteht natürlich nicht nur aus Keynes.
Die moderne Volkswirtschaftslehre hat zwei völlig verschiedene Einflüsse: Einerseits stützt sie sich auf die These über kausale Zusammenhänge, wie wir sie in Reinform in Keynesianismus vorfinden. Andererseits folgt sie dem Positivismus, demzufolge man über Modellisierung von Kausal- und funktionalen Zusammenhängen die Methoden der Naturwissenschaften in der Ökonomie anwendet, die anhand von Beobachtungen getestet werden soll. Das macht einen Großteil der heutigen volkswirtschaftlichen Forschung aus: Man entwickelt Modelle, die eine mathematische Ausdrucksform finden, und danach versucht man über ökonometrische Verfahren zu testen, in welchem Maße diese Modelle mit der beobachteten Wirklichkeit übereinstimmen.
Demgegenüber sind Sie bis heute Anhänger der „Österreicher“.
Die Bedeutung der Österreichischen Schule – von Carl Menger angefangen – liegt darin, dass hier der Realismus erhalten wird, der das gesamte Nachdenken über soziale Verhältnisse und Kausalzusammenhänge bis zum Ende des 19. Jahrhunderts charakterisiert. Insofern führt die Österreichische Schule die klassische Ökonomie weiter. Dieser Realismus, der besonders stark bei Menger und Mises ausgeprägt ist, begeistert mich.