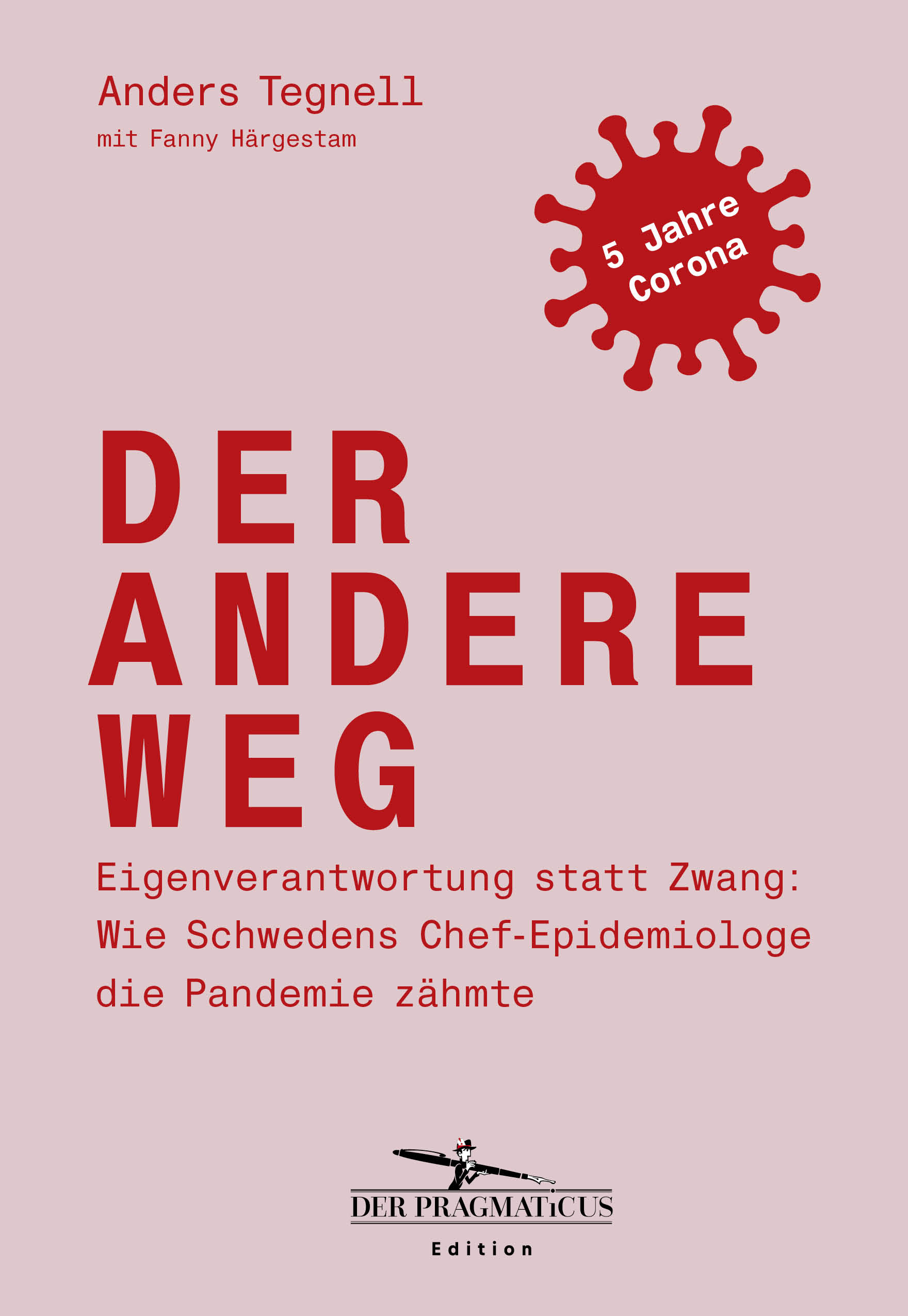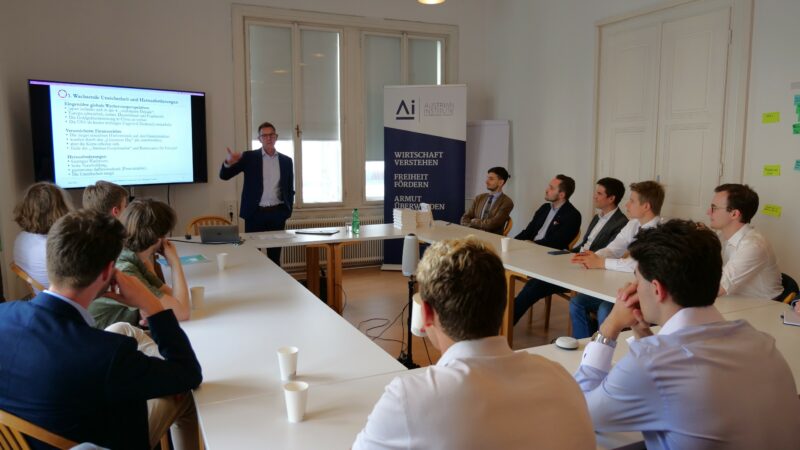Schilder an der Notaufnahme des Sahlgrenska University Hospital in Göteborg, Schweden, die Viruspatienten auffordern, draußen zu bleiben und um Hilfe zu rufen. Aufgenommen während des Corona-Ausbruchs 2020. (Bild: Wikimedia Commons).
Schilder an der Notaufnahme des Sahlgrenska University Hospital in Göteborg, Schweden, die Viruspatienten auffordern, draußen zu bleiben und um Hilfe zu rufen. Aufgenommen während des Corona-Ausbruchs 2020. (Bild: Wikimedia Commons). Man erinnert sich an die endlosen Diskussionen über die Corona Maßnahmen: War der Zwang, waren die Lockdowns gerechtfertigt? Was sagt die Wissenschaft? Anlässlich des fünfjährigen „Corona-Jubiläums“ lud vor kurzem der Pragmaticus Verlag zu einem Expertenforum in das Wiener Josephinum ein. Gastreferent war der schwedische Arzt und Infektionsspezialist Anders Tegnell, der während der Pandemie als Staatsepidemiologe der schwedischen Behörde für öffentliche Gesundheit fungierte.
Häufig wurde der sogenannte schwedische Weg aus dem Ausland medial gescholten, bedingt durch die weltweit einzigartige Vorgehensweise. Dennoch zeigen die langfristigen Erfolge, dass das Beharren auf einem Pfad der Freiwilligkeit statt des Zwanges sich auszahlte.
Die Einladung nach Wien erfolgte im Zusammenhang mit der Veröffentlichung der deutschen Übersetzung des Buches „Tankar efter en pandemi“ („Überlegungen nach einer Pandemie“), das Tegnell zusammen mit der Journalistin Fanny Härgestam 2023 publiziert hat. Nun erscheint das Buch Ende Februar im Benevento Verlag unter dem Titel „Der andere Weg“, eine Leistung des Teams um Pragmaticus-Chefredakteur Andreas Schnauder.
In seinem Gespräch mit Schnauder vermittelte Tegnell seine persönlichen Eindrücke und Überlegungen hinsichtlich der vergangenen Jahre. Insbesondere schilderte er, welche Maßnahmen zur Eindämmung des Virus Schweden ergriff und auf welche sie, im Unterschied zu den meisten anderen Ländern, verzichtete.
Holistischer, nicht monokausaler Ansatz – Empfehlungen statt Maßnahmen
Auf den ersten Blick wird deutlich, dass sich grundlegende Regularien von europäischen Nachbarländern und restlichen Staaten der Welt deutlich unterschieden. Vielfach sollte anstelle von getroffenen Maßnahmen eher von Empfehlungen die Rede sein. Beispielsweise der Rat, wenn möglich Kontakte zu vermeiden, anstatt mit öffentlichen Verkehrsmitteln sich mit dem Fahrrad oder zu Fuß zum Arbeitsplatz zu begeben oder, wenn möglich, zu Hause zu arbeiten. Schulschließungen wurden abgelehnt, die Grenzen blieben geöffnet und es gab keine Quarantäne für Heimkehrer aus Risikogebieten, auch Geschäfte und Restaurants blieben offen. Wer sich krank fühlte, solle zu Hause bleiben, hieß es. Begründet wurde dies mit einem holistischen Ansatz: Statt den Blick ausschließlich auf Fallzahlen sowie die Anzahl positiv Getesteter bzw. Erkrankter zu richten, was dem andernorts praktizierten monokausalen Ansatz entspricht, berücksichtigte man eine Vielzahl von Faktoren.
Wichtig sei auch gewesen zu unterscheiden, ob nun eine Person „an“ oder „mit“ Corona verstorben war. Wo man dies nicht unterschied, wurden die Zahlen der Coronatoten in einem Maße aufgebläht, die zu allgemeiner Panik und zur Rechtfertigung übertriebener, letztlich aber nutzloser oder gar schädlicher Maßnahmen führte.
Weiter Fokus, breite gesellschaftliche Unterstützung
So war es Anders Tegnell zu verdanken, dass sich Schweden – auf der Grundlage eines breiten gesellschaftlichen Konsenses, der diese maßvolle Politik mittrug, – ohne Lockdowns oder Impflicht durch die Corona-Epidemie manövrieren konnte. Diese Politik hatte immer auch weitere Aspekte im Fokus, wie die psychische Gesundheit, die Bildung als Wegebereiterin für ein eigenständiges Leben in der Zukunft, die Wichtigkeit sozialer Bindungen. So kamen nicht nur Virologen zu Wort, sondern man stützte sich auf breit gestreutes Expertenwissen und eine klare Datenlage (die beispielsweise zeigten, dass Lockdowns, Schulschließungen und Verbote nahezu keine Wirkung erzielten).
Häufig wurde der sogenannte schwedische Weg aus dem Ausland medial gescholten, bedingt durch die weltweit einzigartige Vorgehensweise. Dennoch zeigen die langfristigen Erfolge, dass das Beharren auf einem Pfad der Freiwilligkeit statt des Zwanges sich auszahlte. Obgleich die Übersterblichkeit Schwedens in der ersten Jahreshälfte 2020 Anfang 2020 nachweislich höher war – vor allem, weil man versäumte, Heime mit sehr alten Menschen genügend zu isolieren –, fiel diese in den Folgejahren deutlich geringer aus als etwa in Österreich oder Deutschland.
Keine Allianz von Politik und Wissenschaft
Das Vertrauen der schwedischen Bevölkerung, der Politik, der Medien und Institutionen, unterstrich Tegnell, sei stets vorhanden gewesen. Auf die Frage, wieso sämtliche Staaten eher dem chinesischen Beispiel folgten, statt dem schwedischen, meinte der Autor, man müsse hier kontrafaktisch überlegen: Was wäre, wenn das Corona-Virus nicht in der Volksrepublik China, sondern– wie etwa die Schweinegrippe – Mexiko ausgebrochen wäre? Weltweit hätten wohl viele Länder einen anderen Weg eingeschlagen.
Fehlleitend sei auch das Mantra „Follow the Science“ gewesen. Eine Allianz zwischen Politik und Wissenschaft gilt es zu vermeiden, meinte Tegnell. Wissenschaftler haben vielmehr die Aufgabe, Fakten zusammenzutragen und diese in einer verständlichen Weise Politikern zu vermitteln.