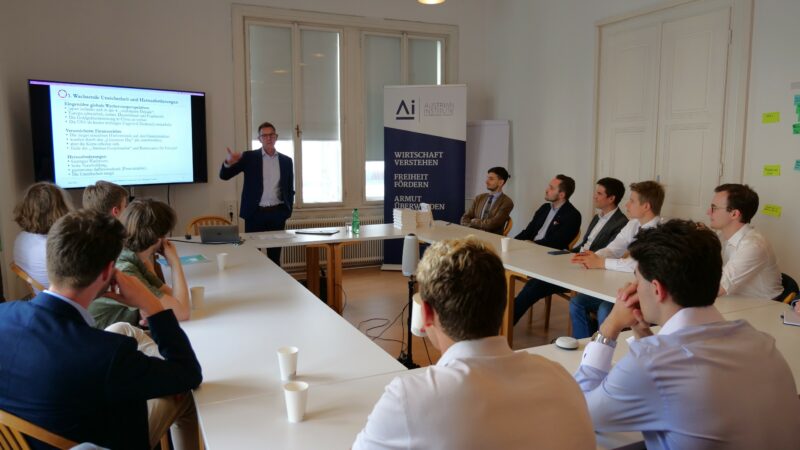Eines der entscheidenden Ereignisse der Französischen Revolution: Der „Ballhausschwur“ mit dem die Deputierten der Nationalversammlung am 20. Juni 1789 schworen, sich nicht zu trennen, bis sie eine neue Verfassung verabschiedet hätten. Die Abbildung zeigt die Zeichnung „Le Serment du Jeu de paume“ aus dem Jahre 1791 von Jacques-Louis David. (Bild: Wikimedia Commons)
Eines der entscheidenden Ereignisse der Französischen Revolution: Der „Ballhausschwur“ mit dem die Deputierten der Nationalversammlung am 20. Juni 1789 schworen, sich nicht zu trennen, bis sie eine neue Verfassung verabschiedet hätten. Die Abbildung zeigt die Zeichnung „Le Serment du Jeu de paume“ aus dem Jahre 1791 von Jacques-Louis David. (Bild: Wikimedia Commons) Jedes Jahr erscheinen zum französischen Nationalfeiertag am 14. Juli, dem Jahrestag des Sturmes auf die Bastille, in den Medien Nachrichten und Artikel über die Französische Revolution. Doch was zum Bild der Revolution wurde und die Franzosen am 14. Juli feiern – das brennende, wenn auch damals fast leere Staatsgefängnis der französischen Monarchie –, ist lediglich ein zum Mythos gewordenes Symbol für die damaligen Geschehnisse, keineswegs jedoch das Hauptereignis einer Revolution, die nicht nur eine Nation veränderte, sondern für den Beginn des modernen Europas steht.
Im Unterschied zur Entwicklung in Großbritannien, die sich auf der Grundlage der angelsächsischen Rechtstradition und als deren kontinuierliche Fortentwicklung vollzog, gab es in Frankreich keinen Weg der Kontinuität, um das Land aus der Sackgasse zu führen und es vor dem politischen und finanziellen Bankrott zu retten.
Noch weniger als der Sturm auf die Bastille stehen Guillotine und jakobinischer Terror für das, was die Französische Revolution in ihrem Wesen ausmachte und trotz ihrer Irrungen und Wirrungen – bis hin zu den blutigen Revolutionskriegen – ihr bleibendes Vermächtnis ist. Nicht einmal Kritiker der Revolution wie Edmund Burke setzten hier an. Vielmehr kritisierten sie den rationalistisch-konstruktivistischen Versuch, unter Missachtung der Kontinuität des historisch Gewachsenen radikal Neues gleichsam aus der Retorte zu schaffen. Diese Kritik traf in der Tat einen wunden Punkt, verfehlte aber letztlich das Entscheidende.
Denn im Unterschied zur Entwicklung in Großbritannien, die sich auf der Grundlage der angelsächsischen Rechtstradition und als deren kontinuierliche Fortentwicklung vollzog, gab es in Frankreich keinen Weg der Kontinuität, um das Land aus der Sackgasse zu führen und es vor dem politischen und finanziellen Bankrott zu retten. Es bedurfte vielmehr eines verfassungsrechtlichen und politischen Bruches mit der Vergangenheit. Das hatte Burke, trotz seiner letztlich freiheitlichen Intentionen, nicht verstanden und so wurde dann dieser freiheitsliebende „Old Whig“ auch im deutschen Sprachraum von seinem Übersetzer, dem Metternich-Berater Friedrich von Gentz, auf tendenziöse Weise als Anwalt der Restauration uminterpretiert und – zu Unrecht – für alle weiterhin den vorrevolutionären Monarchien anhängenden Legitimisten und Konservativen zum Apologeten des Ancien Régime. Doch nicht lange, denn schon sehr bald sollte der Geist der Revolution auch den europäischen Kontinent umgestalten.
Gegen den Absolutismus: Freiheit als Voraussetzung für Frieden
Die Französische Revolution ist nicht unvermittelt vom Himmel gefallen. Sie ist Teil eines säkularen Prozesses, ja einer langanhaltenden „Krise des europäischen Bewusstsein“ (Paul Hazard). Unter den europäischen Intellektuellen und politisch einflussreichen Rechtsgelehrten und Philosophen brodelte es. Die bitteren Erfahrungen mit dem absoluten Staat und seinen Ansprüchen ungeteilter und, wie man nur allzu bald merkte, unkontrollierter und willkürlicher Souveränität führten ganz besonders in Frankreich, wo – im Unterschied etwa zu Preußen – der Absolutismus auch in der Zeit der Aufklärung keineswegs „aufgeklärter Absolutismus“, sondern korrupt und ökonomisch ineffizient war, zur Forderung nach Freiheit als Bedingung und Voraussetzung für ein Zusammenleben der Bürger in Frieden und Sicherheit.
Ein zusätzliches Ferment waren die „Enzyklopädisten“, die mit ihrer Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers (1751-1780 in 35 Bänden und mit Beiträgen von 142 Autoren erschienen) nicht nur beanspruchten, das gesamte Wissen ihrer Zeit zusammenzufassen und allen zugänglich zu machen, sondern dabei gegenüber den herrschenden Autoritäten inklusive der Kirche und den Dogmen des christlichen Glaubens durchaus kritische Töne anschlugen. Auch dadurch wurden die gebildeteren Schichten des Bürgertums und nicht wenige Vertreter des Adels, von denen viele an der Enzyklopädie mitarbeiteten, für die Annahme der Ideen der Revolution vorbereitet. Interessant ist, dass die Stoßrichtung der Enzyklopädie durchaus anglophil war: Ganz im Sinne ihres gelegentlichen Mitarbeiters Voltaire und dessen Lettres Anglaises war sie gegen Descartes gerichtetund verbreitete gegen die Cartesianische die Newtonsche Physik, und gegen Cartesianischen Rationalismus die empiristische Philosophie, vor allem jene John Lockes.
England hingegen war schon von seiner bis auf das Mittelalter zurückreichenden Tradition her antiabsolutistisch und natürlich auch empiristisch orientiert. Der Versuch des katholisierenden Jakobs II. aus dem Hause Stuart in England ein absolutistisches Regime einzuführen und die Krone zu rekatholisieren, hatte im Jahre 1688 zur „Glorious Revolution“ geführt: der Wiederherstellung der Kontinuität, vor allem der Herrschaft des Parlamentarismus sowie der parlamentarischen Beschränkung und Kontrolle königlicher Macht – all dies im Namen des Protestantismus und geprägt von der Gegnerschaft zum katholischen Frankreich und einer zunehmenden, geradezu hysterischen Angst vor einer päpstlichen Einflussnahme auf die Geschicke Großbritanniens. Auch der Whig Edmund Burke – ein anglikanischer Ire – feierte diese Glorreiche Revolution als Triumph der Freiheit und des Parlaments über die Krone, denn die Ereignisse von 1688 stellten die antiabsolutistische Tradition (King-in-parliament) und damit die Kontinuität des Rechts wieder her.
Im absolutistischen Etatismus gab es keine Bürger, sondern nur Untertanen. Macht war unkontrolliert und Untertanen hatten keine Rechte. Freie Meinungsäußerung oder gar Kritik der Herrschenden waren verpönt, das wirtschaftliche Leben wurde von oben organisiert.
Das politische Freiheitsethos, wie es sich im Laufe des 17. und 18. Jahrhunderts gegen den Absolutismus entwickelte, kann zwar auch als bloße Ausweitung der politischen Friedensmoral begriffen werden, wie sie sich in Reaktion auf die blutigen konfessionellen Bürgerkriege des 16. und 17. Jahrhunderts vor allem in der Form der Souveränitätslehre des französischen Juristen Jean Bodin und jener des englischen Philosophen Thomas Hobbes artikuliert hatten. Diese waren der Meinung, es brauche zunächst einmal einen starken, nach innen souveränen Herrscher, der durch Ausklammerung strittiger ideologischer und religiöser Fragen den Frieden zwischen den verfeindeten Parteien herstellt. Doch ging der Antiabsolutismus des 17. und 18. Jahrhunderts weit über solche Friedensformeln hinaus, die, wie Hobbes und Bodin, den Bürgerkrieg als das höchste aller Übel betrachteten.
Im real existierenden absolutistischen Etatismus gab es keine Bürger, sondern nur Untertanen. Macht war unkontrolliert und Untertanen hatten keine Rechte. Freiheit war dem Frieden untergeordnet, Eigentum nicht gesichert. Freie Meinungsäußerung oder gar Kritik der Herrschenden waren verpönt, das wirtschaftliche Leben wurde – zumindest nach französischem Verständnis – von oben organisiert. In Frankreich umgab sich der Monarch mit einer „Noblesse de Robe“: Emporkömmlingen, Opportunisten und Schmeichlern, die sich auf Kosten der in ihrer Mehrheit armen Bevölkerung bereicherten und das Land nach und nach zugrunde richteten.
Ohnmacht der Philosophen – Herrschaft des Rechtes
Dagegen erhoben Intellektuelle zwar Einspruch, aber ohne Erfolg. So schrieb der holländische Linsenschleifer und Philosoph Baruch Spinoza, wo es keine Freiheit (der Meinungsäußerung, der Religion, der Wahrheitssuche) gebe, da könne kein Friede herrschen. Spinoza war zwar der Souveränitätslehre Hobbes‘ und ihrem absolutistischen Friedensethos verhaftet, wollte jedoch deren freiheitsgefährende Einseitigkeit überwinden. Deshalb, so Spinoza, sei der Staat, gerade als Friedensgarant, vor allem der Beschützer menschlicher Freiheit [Spinoza, Theologisch-politischer Traktat, Vorrede]. Ja, Spinoza formuliert programmatisch: „Der Zweck des Staates ist die Freiheit“ und ein Staat, der diese unterdrückt, besitzt keine Legitimität [ebd. Kap. 20]. Das war neu: Frieden bedarf nicht nur effizienter souveräner Herrschaft, sondern der Freiheit des Bürgers. Ohne Freiheit, kein Frieden.
Spinozas Kompromiss zwischen Souveränität und Freiheit blieb jedoch bloßer philosophischer Appell. Dass solche Appelle zuweilen auch historisch-reale Substanz bekommen konnten, war nicht das Werk der Philosophen. Das gilt auch für den liberalen Philosophen John Locke, für den kein Staat der Eigentümer der Gesellschaft oder des Individuums sein kann. Jede Regierungsgewalt, so heißt es bei ihm, steht im Dienste der Gesellschaft, und diese muss die freie Entwicklung der individuellen Person ermöglichen. Die Regierenden sind nur Treuhänder der Gesellschaft; Regierung ist ein „Trust“, d.h. sie handelt treuhänderisch im Auftrag der sich zur Gesellschaft zusammenschließenden Individuen und in ihrem Dienste. Die Gesellschaft als „Community“ von Individuen kann deshalb jede Regierung im Bedarfsfall abberufen und durch eine neue ersetzen.
Englisches Freiheitsbewusstsein war zunächst und vor allem Rechtsbewusstsein. Und als solches ist es die tragende Säule des liberalen politischen Ethos der Moderne geworden.
Dies war in eine konkrete geschichtliche Situation hineingesprochen: in die Situation des zu Beginn des 18. Jahrhunderts im Gefolge der Glorious Revolution von 1688 erstarkenden englischen Parlamentarismus. Locke seinerseits war als Schiffsarzt mit der Invasionsflotte des neuen englischen Königs, Wilhelm von Oranien – Wilhelm III. –, aus den Niederlanden nach England gekommen [vgl. Kluxen 1983]. Locke schrieb also nicht im luftleeren Raum oder im philosophischen Elfenbeinturm, er war Teilnehmer und Zeuge eines durchaus revolutionären politischen Prozesses.
Der neu erstarkte englische Parlamentarismus war Frucht einer langen Entwicklung, die letztlich im Mittelalter begonnen hatte. Er versteht die im Jahre 1215 verfasste „Magna Charta“, die erste und gleichsam embryonale Gestalt des englischen Verfassungsrechts, als sein Gründungsdokument. Dabei ging es in den folgenden Jahrhunderten nicht allein um den Prozess der Herausbildung eines gegenüber der Krone immer mehr Macht gewinnenden Parlaments, sondern auch um die Entstehung eines unabhängigen Juristenstandes, der typisch angelsächsischen Herausbildung des durch Richterrecht weiterentwickelten Common Law und des aus beiden resultierenden Verständnisses der Rule of Law: der Herrschaft des Rechts und der auf dieser Grundlage vom Parlament erlassenen Gesetze gegenüber Machtansprüchen und politischer Willkür der Krone – man denke nur an die „Petition of Right“ von 1628 (s. unten) und an die, von den Ideen Lockes beeinflusste, „Bill of Rights“ von 1688/89, in der zum ersten Mal das Prinzip „No taxation without representation“ – also das Verbot für die Krone, Steuern ohne Zustimmung des Parlaments zu erheben, – rechtswirksam niedergelegt wurde, ein Prinzip, das dann im Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg (1775-1783) zum revolutionären Schlachtruf der Kolonien gegen die britische Krone werden sollte!
„Rule of Law“ – „Herrschaft des Rechts“ als politische Institution
Es waren also institutionelle Entwicklungen und Gegebenheiten, allen voran die Existenz von Rechtsinstitutionen und des typisch englischen Rechtsbewusstseins, die den literarischen und damit auch politischen Erfolg eines John Locke überhaupt erst möglich machten. Englisches Freiheitsbewusstsein war zunächst und vor allem Rechtsbewusstsein. Und als solches ist es die tragende Säule des liberalen politischen Ethos der Moderne geworden.
Dies widersprach nur teilweise den Positionen eines Jean Bodin, des französischen Theoretikers des souveränen Staates, der als Instanz des Friedens über den konfessionellen Parteien steht. Denn Bodin anerkannte immerhin unhintergehbares Naturrecht, dies im Unterschied zu Thomas Hobbes, dessen Anliegen zwar in die gleiche Richtung zielte – Frieden um den Preis absolutistischer Rechtssetzungskompetenz des Souveräns – , dies jedoch mit Mitteln, die sich vor allem gegen die Tradition des Common Law als „historisch gewachsene Vernunft“ richtete, an dessen Stelle Hobbes das Willkürrecht des Souveräns setzte.
Rule of Law bedeutete, dass sowohl gegenüber der Krone wie auch gegenüber dem Parlament die Möglichkeit bestand, Freiheitsrechte vor einem unabhängigen Richter einzuklagen, und dass die Souveränität der Krone sowohl durch das Recht begründet wie auch durch dieses gebunden verstanden wurde.
Als integraler Bestandteil des sich stetig entwickelnden Common Law begründete die englische Tradition der Rule of Law ein authentisches Verfassungsrecht. Dies machte bereits der im Jahre 1676 verstorbene Chief Justice Sir Matthew Hale gegenüber Hobbes geltend. Letzterer versuchte – inspiriert durch Francis Bacon, dessen Sekretär er ein Zeitlang gewesen war –, das Common Law zu diskreditieren, um, wie erwähnt, geltendes Recht auf statute law, d.h. positives Gesetzesrecht zu limitieren [vgl. Hale, 1956-64; Rhonheimer 2000].
Rule of Law bedeutete, dass sowohl gegenüber der Krone wie auch gegenüber dem Parlament die Möglichkeit bestand, Freiheitsrechte vor einem unabhängigen Richter einzuklagen, und dass die Souveränität der Krone als sowohl durch das Recht begründet wie auch durch dieses gebunden verstanden wurde (Henry de Bractons Prinzip rex infra legem, „der König steht unter dem Gesetz“, aus dem späteren 13. Jahrhundert, so sinngemäß in Bractons De legibus & consuetudinibus Angliæ). Die Magna Charta Libertatum aus dem Jahre 1215 hatte diese Entwicklung in die Wege geleitet, auch wenn sie noch ganz und gar den Vorstellungen der Feudalzeit verhaftet war. Doch widersprach die englische verfassungsrechtliche Entwicklung von Anfang an klar und deutlich dem aus dem römischen öffentlichen Recht stammenden Grundprinzip des kontinentalen Absolutismus Quod principi placuit legis habet vigorem: „was dem Herrscher gut dünkt, hat Gesetzeskraft“ [vgl. dazu Rhonheimer 2012, 107].
Die Magna Charta war letztlich der Ursprung des „Urgrundrechtes“ [Kriele, 1990, 149ff.], genannt Habeas corpus: Das Recht eines jeden „freien Mannes“, nur aufgrund richterlicher Verfügung verhaftet werden zu können. Ein „freier Mann“, das waren im Jahre 1215 freilich lediglich die kleine Minderheit der Barone. Die Magna Charta ist zwar noch Feudalrecht, aber aus ihrem eigenen Geist heraus entwickelte sie sich allmählich zum allgemeinen Freiheitsrecht.
In der von dem damaligen „Chief Justice“ Edward Coke formulierten Petition of Right (1628) – auch sie ist bis heute englisches Verfassungsrecht – heißt es dann in expliziter, ja geradezu mythisierender Bezugnahme auf das Dokument von 1215 und in Übernahme einer bereits im 14. Jahrhundert erfolgten Umformulierung statt „kein freier Mann“ (no free man), womit ja allein die Barone gemeint waren, nur noch: „kein Mensch“ („no man, of whatever estate or condition he may be“). Das Recht, nur durch Richterspruch – also im Rahmen eines due process, eines ordentlichen Rechtsverfahrens – der Freiheit beraubt werden zu können, galt nun zumindest auf dem Papier für jedermann.
Locke, Montesquieu und die „englische Verfassung“
Unabhängigkeit der Richter – sie waren unabsetzbar – und Teilung der Gewalt zwischen Parlament, Krone und Justiz, lieferten das Material für das berühmte sechste Kapitel des elften Buches von Montesquieus „Geist der Gesetze“. Es trägt nicht zufällig den Titel „Über die Verfassung Englands“ – obwohl es ja eine solche Verfassung im heutigen Sinne gar nicht gab (und bis heute nicht gibt). Montesquieu hat die Gewaltenteilung nicht erfunden, wie man in der Schule lernt, sondern beschrieb den Franzosen lediglich, freilich in idealisierter Weise, dieses „herrliche System“ der Engländer, das „in den Wäldern aufgefunden wurde“.
Seither gilt Montesquieu als „Erfinder“ der Gewaltenteilung – nicht ganz zu Unrecht, denn er lieferte aufgrund der englischen Verfassungsrealität dazu die Theorie (wobei auch der englische Verfassungstheoretiker William Blackstone und die Beschreibung des Parlamentarismus in seinen – zwischen 1765 und 1769 veröffentlichten – Commentaries on the Laws of England als ein System von „checks and balances“ zu erwähnen wäre). Montesquieu meinte allerdings zu Unrecht, die Engländer hätten die Idee ihrer Regierungsform von den alten Germanen geerbt (das war mit der oben zitierten Anspielung auf die „Wälder“ gemeint). Das stimmt nachweislich nicht, denn das germanische Recht war Genossenschaftsrecht und sollte erst später seinen Einfluss geltend machen. Und es gab ja auch gar keine „englische Verfassung“, und es gibt sie auch heute nicht in kodifizierter Form, wohl aber als rechtliche Normen des Common Law und als Parlamentsgesetze, deren verfassungsrechtliche Bedeutung anerkannt ist – auch dies bis heute.
Bereits vor Montesquieu jedoch hatte John Locke die englische Verfassungswirklichkeit in politische Philosophie umgesetzt. Allerdings: Lockes Denken war nicht im eigentlichen Sinne „konstitutionalistisch“. Der Kern seiner politischen Lehre zielte nicht darauf, Grundrechte der Individuen durch unabhängige Richter vor den politischen Gewalten zu schützen, sondern die Ziele der Individuen durch eine in ihrem Auftrag handelnde, und deshalb ihnen gegenüber verantwortliche, Regierung zu fördern. Lockes souveräne Community, die durch Sozialvertrag gebildete bürgerliche Gesellschaft, errichtet keineswegs eine Verfassung, sondern setzt unmittelbar eine parlamentarische Regierung ein (das Parlament ist bei Locke die Regierung; das moderne Kabinett bildete sich, als eine Art Parlamentsausschuss, erst im Laufe des 18. Jahrhunderts heraus).
Erst in den amerikanischen Kolonien, die durch Montesquieus Theorie der englischen Verfassung geprägt waren, las man Locke in einer konstitutionalistischen Optik, was dann auch zu verschiedenen Bürgerrechtserklärungen führte, wovon die berühmteste die hauptsächlich von George Mason verfasste Virginia Declaration of Rights (1776) ist.
Wie aus dem Kapitel 13 des Second Treatise on Government hervorgeht, war Locke also immer noch ein Theoretiker der Souveränität, nun aber ein solcher der Souveränität der community und deren Treuhänder: des Parlamentes. Gemäß dem deutschen Staatsrechtler Martin Kriele bestand Lockes Einfluss in England nicht darin, die individuellen Freiheitsrechte zu fördern, sondern vielmehr die Parlamentssouveränität zu stärken [Kriele 1990, 202], was sich u.a. in dem geradezu unerhörten Faktum einer zeitweiligen Suspendierung des Habeas corpus-Rechtes – also des Grundrechtes schlechthin – durch das Parlament anfangs des 19. Jahrhunderts manifestierte. Das war der Preis, den man dafür bezahlen musste, keine geschriebene Verfassung zu besitzen, obwohl englische Verfassungstheoretiker, wie später der bereits genannte William Blackstone und viel später dann Walter Bagehot, nicht fehlten. Erst in den amerikanischen Kolonien, die durch Montesquieus Theorie der englischen Verfassung geprägt waren, las man Locke in einer konstitutionalistischen Optik, was dann auch zu verschiedenen Bürgerrechtserklärungen führte, wovon die berühmteste die von George Mason – mit wichtigen Korrekturen von James Madison – verfasste Virginia Declaration of Rights (1776) ist. Was also heute jedes Kind vor allem in den angelsächsischen Ländern in der Schule lernt, nämlich John Locke sei der „Entdecker“ der Menschenrechte gewesen, stimmt so nicht.
Amerikanisches Verfassungsdenken und Französische Revolution
Die konstitutionalistische Umformung der Ideen Lockes ist wie gesagt dem Einfluss Montesquieus zuzuschreiben – selbstverständlich hatte dieser auch Locke gelesen –, ebenso sehr entspringt der amerikanische Konstitutionalismus aber auch dem in den amerikanischen Kolonien weiterlebenden, typisch angelsächsischen, politisch-juristischen Geist, der sich gerade auch im Kampf gegen das englische Mutterland weiterbilden konnte.
Dazu kam in Amerika ein zweites, gleichsam demokratisches Ferment: Der auf die Pilgrim Fathers zurückgehende, ausgeprägte Gemeinschaftssinn des presbyterianischen Calvinismus – eine so benannte Gruppe sogenannter Nonkonformisten übersiedelte 1620 mit dem Wunsch nach freier Ausübung ihrer Religion mit dem Segelschiff „Mayflower“ von England aus nach Amerika und landete im heutigen Plymouth (Massachusetts).
Eine historisch einmalige Symbiose vielfältiger ideeller Wurzeln mit politischem Realitätssinn führte die amerikanischen Kolonien schließlich dazu, die Menschenrechte als positives Recht zu proklamieren, d. h. als vor Gericht einklagbare Rechte des Einzelnen, und sich aufgrund einer geschriebenen Verfassung als Bundesstaat zu konstituieren, der sich von Anfang an als eine Regierung durch das Volk und für das Volk, d.h. als Demokratie verstand –- wenn auch mit dem anfänglichen, aus der britischen Kolonialzeit geerbten Makel der Sklaverei in den Südstaaten.
Die aus Amerika stammende Forderung des rechtlichen Schutzes individueller Freiheit überquerte in Windeseile den Atlantik und wurden nachweislich zur Grundlage der Ideen der Französischen Revolution. Diese „atlantische“ Sicht ist zwar in Frankreich selbst keineswegs verbreitet, geschweige denn populär.
Die bereits in der von George Mason verfassten Virginia Declaration of Rights von 1776 dominierende Grundidee war, politische Macht und die Menschen, die sie ausüben, dem Recht und institutioneller Kontrolle zu unterwerfen, um auf diese Weise die Freiheit und die freie Entfaltung des Individuums zu garantieren. Die aus Amerika stammende Forderung des rechtlichen Schutzes individueller Freiheit überquerte in Windeseile den Atlantik und wurden nachweislich zur Grundlage der Ideen der Französischen Revolution. Diese „atlantische“ Sicht ist zwar in Frankreich selbst keineswegs verbreitet, geschweige denn populär, da es zum Selbstverständnis der Franzosen gehört, sich als Erfinder der Menschenrechte zu betrachten [vgl. die Diskussion zwischen Georg Jellinek und Émile Boutmy, Boutmy, 1964]. Die atlantische Sicht, die amerikanische und französische Revolution als in ihren geistigen Grundlagen interdependente Ereignisse sieht, entspricht aber wohl weitgehend der historischen Wahrheit und hilft auch, ein oft einseitiges Bild der Französischen Revolution zu korrigieren.
In der Tat fand die Virginia Declaration of Rights ihre Nachahmung in der, auch infolge des Einflusses von Abbé Sieyès – eigentlich Emmanuel Joseph Sieyès – philosophisch-grundsätzlicher gehaltenen französischen Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte von 1789, die als integraler Bestandteil der dann vom Verfassungskonvent ausgearbeiteten neuen Verfassung von 1791 galt. Im Wesentlichen wurde die Erklärung von 1789 jedoch von Lafayette – Marquis de La Fayette, Mitkämpfer im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg und Freund Washingtons – mit redaktioneller Hilfe von Thomas Jefferson, dem Verfasser der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, ausgearbeitet. Letzterer weilte damals als Botschafter der kurz zuvor gegründeten Vereinigten Staaten von Amerika in Paris [vgl. dazu Palmer, 1959; Schnur (Hrsg.) 1964; Bobbio 1990, 89-120]. Lafayette überbrachte seinem Freund Washington dann auch als Geschenk den Schlüssel der Bastille, der in Washingtons Landsitz Mount Vernon hing, bis ihn Präsident George Bush (Senior) im Jubiläumsjahr 1989 dem französischen Präsidenten Mitterand „zurückschenkte“.
Die Geburt des modernen Konstitutionalismus war Frucht einer langen Entwicklung der Rechtsinstitutionen und des Rechtsbewusstseins, der Herausbildung von Institutionen also, die von Persönlichkeiten mit einem ausgesprochenen juristischen Realitätssinn entworfen und realisiert wurden. Genau deshalb darf politische Geschichte nicht auf die Geschichte politischer Ideen oder auf die Literaturgeschichte philosophischer Texte beschränkt werden. Ebenso wichtig ist die Institutionengeschichte und das Denken derjenigen die diese Entwicklung als Protagonisten vorantrieben; in England beispielsweise „Chief Justice“ Sir Edward Coke [vgl. Beauté, 1975], in den amerikanischen Kolonien Leute wie Alexander Hamilton, James Madison und John Jay, die Verfasser der Federalist Papers [Hamilton, Madison, Jay, 1993]. Dennoch handelte es sich dabei nicht um die Schaffung eines Staatswesens aus der Retorte, sondern eher um die Umformung der Ergebnisse einer langen Entwicklung, die eine Vielzahl von Komponenten in sich vereinigte, dabei aber keineswegs gleichsam auf dem Reißbrett entworfen wurde, sondern Frucht eines in seiner abschließenden Form und in seiner Gesamtheit nichtintendierten politischen, rechtlichen und gesellschaftlichen Prozesses war.
Die erwähnten Federalist Papers waren ursprünglich eine Serie von Artikeln, die erfolgreich für die Schaffung eines amerikanischen Bundesstaates im Sinne des Verfassungsentwurfs von 1787 plädierten. Die Verfasser, die ihre Artikel zunächst unter dem Pseudonym „Publius“ in verschiedenen New Yorker Zeitungen veröffentlicht hatten, waren keine Theoretiker: Hamilton war Politiker, Ökonom und Finanzfachmann; Madison war ebenfalls Politiker und wurde vierter Präsident der Vereinigten Staaten; Jay war Jurist und Politiker und wurde später Oberster Bundesrichter.
Die Ideen von 1789: Import aus den USA?
Das zeigt, wie tiefgreifend das äußerst verbreitete Missverständnis ist, die Französische Revolution im Lichte der Schriften Jean-Jacques Rousseaus zu interpretieren oder deren Ausbruch gar als Folge von Rousseaus Ideen zu verstehen. Die Französische Revolution ist in Wirklichkeit ein komplexes und verschlungenes historisches Ereignis, das sich über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte hinzog – führende Historiker der Französischen Revolution wie François Furet meinen bis nach 1870, der Gründung der Dritten Republik. In einem gewissen Sinne ist zumindest ihre erste Etappe erst mit der Promulgation des Code Napoléon (1804) des von Napoleon erlassenen bürgerlichen Zivilgesetzbuches zum vorläufigen Abschluss gekommen. Es beinhaltet nicht mehr ein Recht für die Untertanen eines Monarchen und die Privilegierung der Aristokratie, sondern erhebt ein für alle gleich geltendes Recht freier Staatsbürger zur Geltung und schreibt damit gleichsam die egalitäre Stoßrichtung der Revolution fest.
In diesem Gesetzeswerk also, das – ähnlich wie das frühere Preußische Landrecht und das österreichische Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch – den liberalen Geist der Aufklärung und bürgerlicher Emanzipation atmete, ist die Französische Revolution zum Abschluss gekommen – und nicht in dem totalitären Geist der Jakobiner, die nur kurz den Ton angaben, aber zum Symbol für die Verirrungen eines zeitweise aus dem Ruder gelaufenen Umsturzes wurden.
Auch wenn jakobinischer Terror und seine ideologischen Verirrungen Teil der Französischen Revolution sind, wäre es ein grober Fehler, die Revolution, ihre freiheitliche, bürgerlich-egalitäre Intention und ihre Leistung, nur im Lichte der jakobinischen Phase zu interpretieren.
Auch wenn jakobinischer Terror und seine ideologischen Verirrungen Teil der Französischen Revolution sind, wäre es ein grober Fehler, die Revolution, ihre freiheitliche, bürgerlich-egalitäre Intention und ihre Leistung, nur im Lichte der jakobinischen Phase zu interpretieren. Allerdings ist der totalitäre Ungeist der Jakobiner – das Programm des öffentlichen Zwangs zur Tugend – der modernen europäischen Geschichte als Widerpart zu allem Liberalen und zum Geist bürgerlicher Freiheit bis heute erhalten geblieben und treibt weiter seine Blüten. Jakobiner haben sich übrigens immer gerne – zu Recht oder Unrecht – auf Rousseau berufen.
Rousseau ist allerdings ein komplexer und auch in sich widersprüchlicher, eigentlich nostalgischer Denker. Er ist modern und in seinem platonischen Aspekt der Suche nach dem idealen Gesetzgeber gleichzeitig geradezu antik. Vielleicht ist sein Denken gerade deshalb, und weil die Mixtur impraktikabel und illusorisch ist, voller Sprengkraft. Deutlich wird dies in Rousseaus späteren Eingeständnis voller Resignation, sein idealistisches Konzept einer „reinen“ Herrschaft der Gesetze, bei der aller Egoismus der Partikularinteressen ausgeschaltet und eine volle Identität von Regierenden und Regierten besteht, habe sich als impraktikabel erwiesen; deshalb sei eigentlich nur noch der nackte Despotismus des faktischen Machthabers möglich.[1] Gerade die marxistische Utopie beruht ja auf diesem „identitären“ Programm, und mündet deshalb, versucht man sie zu verwirklichen, notgedrungen in Despotie und Unterdrückung.
Die eigentliche Revolution: Die „Nationalversammlung“
Hinsichtlich ihrer konkreten politischen Dynamik entsprang die Französische Revolution – ganz im Unterschied zu den Ereignissen in den amerikanischen Kolonien – zwar den Ungerechtigkeiten eines Adel und höheren Klerus auf Kosten der großen Masse der Bürger und Bauern privilegierenden Systems verbunden mit einem dysfunktionalen Regierungssystem sowie einer durch das Zusammenspiel dieser Faktoren hervorgerufenen Finanz- und Nahrungsmittelkrise. Die geistigen Grundlagen der Revolution waren jedoch, wie erneut zu betonen ist, vielschichtiger und vor allem: nicht rein französisch.
Sie entsprangen einer Mischung von angelsächsischem Verfassungsdenken (Konstitutionalismus) bzw. Parlamentarismus und französischem doktrinärem Rationalismus, vertreten vor allem durch den bekanntesten publizistischen Aktivisten der Revolutionszeit (er war geweihter katholischer Priester), den bereits erwähnten Abbé Sieyès, der vor allem einen Gegner identifizierte: Den Adel und seine Privilegien. Sieyès‘ 1788 erschienener Essai sur les privilèges war nur der Auftakt zu seiner ein Jahr später erschienen berühmtesten Schrift Qu‘est-ce que le Tiers-État? – „Was ist der Dritte Stand?“ –, in dem der den Dritten Stand – Bürgertum und niederen Klerus – mit der Nation gleichsetzte, eine, wie wir gleich sehen werden, brisante und folgenreiche Aussage.
Das politisch und rechthistorisch ausschlaggebende Ereignis, ja die eigentliche Revolution im präzisen Sinne eines radikalen Bruchs der Rechtskontinuität mit dem Ancien Régime war nicht der Sturm auf die Bastille und die damit verbundenen gewaltsamen „revolutionären“ Ereignisse
Genau deshalb war das politisch und rechthistorisch ausschlaggebende Ereignis, ja die eigentliche Revolution im präzisen Sinne eines radikalen Bruchs der Rechtskontinuität mit dem Ancien Régime, nicht der Sturm auf die Bastille und die damit verbundenen gewaltsamen „revolutionären“ Ereignisse, sondern eine bereits zuvor getroffene Entscheidung der sogenannten Generalstände, der – nach Jahrzehnten der praktischen Ausschaltung – vom König 1789 unter Druck einberufenen Versammlung der drei Standesgruppen: Adel, (höherer) Klerus (vor allem Bischöfe, auch sie durchwegs Adlige) und der „Dritte Stand“, wie erwähnt bestehend aus Bürgern und niederem Klerus.
Traditionellerweise hatte jeder Stand kollektiv eine Stimme, was auf eine stetige Stimmenmehrheit von Adel und höherem Klerus von 2:1 gegenüber dem Dritten Stand hinauslief – obwohl Letzterer zahlenmäßig viel mehr Vertreter in der Versammlung stellte. Dieser Abstimmungsmodus wurde nun im Juni 1789 über den Haufen geworfen, und zwar mit dem von Abbé Sieyès stammenden Argument, die Vertreter des Dritten Standes (ca. 98 Prozent der Stimmen) verträten praktisch die Gesamtheit der Franzosen und sei damit mit der Nation identisch. Darauf erklärte sich die Versammlung der Generalstände, gegen den Widerstand des Königs, am Ende jedoch mit dessen notgedrungener Zustimmung, zur Assemblée nationale, zur „Nationalversammlung“! Genau das war die eigentliche Revolution. Adel und höherer Klerus waren entmachtet, der König musste fortan mit dem Bürgertum zusammenarbeiten. Der Name des französischen Parlaments lautet noch heute Assemblée Nationale.
Die Französische Revolution war in ihrem Ursprung keineswegs anti-monarchisch, sondern anti-aristokratisch. Und sie plädierte für eine parlamentarische Repräsentation der Gesamtheit der Nation.
Die Französische Revolution war also in ihrem Ursprung keineswegs anti-monarchisch, sondern anti-aristokratisch. Und sie plädierte für eine parlamentarische Repräsentation der Gesamtheit der Nation, der sich auch Vertreter des Ersten und Zweiten Standes anschließen durften, was in einigen Fällen auch geschah (man denke an Mirabeau, einen der Protagonisten der Nationalversammlung), und an deren Beschlüsse sich – ganz nach dem englischem Vorbild des King-in-parliament – auch der König halten müsste. Dass der an sich populäre Louis XVI. wenig später, wortbrüchig unter hinter dem Rücken der Revolutionäre, gemeinsam mit den Monarchen Europas Restaurationspläne vorbereitete, führte zur Abkehr der Revolution von der Monarchie, zum Volkszorn und nicht zuletzt schließlich auch zum Aufstieg der Jakobiner und ihrem Terrorregime, dessen erstes Opfer, nach misslungener Flucht, der König selbst wurde.
Doch zurück zu Sieyès wie auch dem zur Zeit der Revolution als US-Botschafter in Paris tätigen Thomas Jefferson: Sie waren Anhänger einer parlamentarischen Repräsentativverfassung angelsächsischer Prägung (in Kombination mit einem Grundrechtskatalog im Range von Verfassungsrecht). Genau dies war das pure Gegenteil der Ideen Rousseaus, der jegliche Repräsentation als im Widerspruch zur Volkssouveränität stehend ablehnte und in dessen Konzeption keine Raum für bürgerliche „Grundrechte“, sondern eher für Pflichten des Bürgers ist.
Allerdings verwirklichten die Franzosen das System der parlamentarischen Repräsentation in der ersten Verfassung, jener von 1791, auf höchste unglückliche Weise: Infolge des Zensuswahlrechtes und natürlich des Ausschlusses der Frauen aus der Politik repräsentierte die Nationalversammlung die Nation nur sehr unvollkommen, was dann wenig später die Jakobiner in ihrer Agitation gegen die Verfassung propagandistisch ausnützen konnten. Das Zensuswahlrecht war praktisch die Umkehrung des Prinzips „no taxation without representation“, also „no representation without taxation“: wer nicht Steuern zahlt – und, da es nur Vermögenssteuern gab, hieß das in der Praxis: wer keine Eigentum oder Grundbesitz besaß, – hat keine Recht, Repräsentant der Nation zu sein. Selbstredend war damit auch die bäuerliche Landbevölkerung von der politischen Beteiligung ausgeschlossen.
Zweitens enthielt die Verfassung von 1791 keine Bestimmungen für eine mögliche Verfassungsrevision und das dafür einzuhaltende Prozedere. Das hieß: Man konnte diese Verfassung wiederum nur durch eine neuerliche Revolution außer Kraft setzen, was 1793 durch die Jakobiner geschah. Folge war dann das pure Gegenteil, nämlich eine plebiszitäre „Demokratie“, die die Idee der Repräsentation und natürlich auch der bürgerlichen Grundrechte mit Füßen trat und schließlich in den Terror mündete. Man möchte solches nicht einmal mit Rousseau in Verbindung bringen.
Der rationalistisch-konstruktivistische Versuch der französischen Verfassungstheoretiker, allen voran Sieyès, ein in keiner Weise in der französischen Verfassungstradition und Geschichte wurzelndes Staatswesen gleichsam aus traditionsfremden intellektuellen Ressourcen zu begründen, ist mit einigem Recht, wenn auch, wie oben gesagt, auch mit einigem Unverständnis, von Edmund Burke kritisiert worden. Hätte es eine Alternative zum radikalen Neuanfang gegeben? Die totale Blockade durch Krone und Adel und deren Unverständnis für die Nöte der Menschen, ja der blanke Egoismus der „Noblesse de Robe“, wie auch, auf der anderen Seite, die verfassungsrechtliche Unmöglichkeit einer Neuordnung des Staatswesens aufgrund des Bestehenden und die geradezu schreiende Inkompetenz des Königs und seiner Entourage, ließen kaum eine andere als die revolutionäre Option offen. In Wirklichkeit, so könnte man argumentieren, hätte es noch viel schlimmer kommen können, nämlich dann, wenn die Hilfe aus den USA und deren Vorbilder wie jene der Virginia Declaration of Rights gefehlt hätten und Frankreichs Politiker und Juristen 1789 ohne die intellektuelle Unterstützung und Befruchtung der Amerikaner dagestanden wären. Wie jedoch die Geschichte ohne Revolution weitergegangen wäre – besser? schlechter? –, kann niemand wissen und ist eine müßige Frage.
Rousseau als Antipode der Französischen Revolution
Weder die amerikanischen Gründerväter noch die französischen Revolutionäre der ersten Stunde (wie Abbé Sieyès oder Mirabeau) hielten sich an die Vorstellungen Rousseaus. Wie bereits gesagt, war dessen Idee der Volkssouveränität – eine Art „Absolutismus des Volkes“ – mit der Idee der Menschenrechte als positive, verfassungsmäßig garantierte Grundrechte des menschlichen Individuums und Bürgers – und damit der Idee einer Unterordnung von Souveränität und Regierungsgewalt unter die Herrschaft des Rechtes – kaum vereinbar. Ebenso wenig stimmten Rousseaus Vorstellungen mit der Idee einer Regierung durch parlamentarische Repräsentation überein, da Rousseau die Idee der Repräsentation als Relikt des Feudalismus zugunsten der erwähnten Identität von Regierenden und Regierten ablehnte.
Die Vorstellungen der französischen verfassungsgebenden Nationalversammlung von 1789 kontrastierten erheblich mit denjenigen Rousseaus, dessen Ideen auf die Französische Revolution überhaupt einen viel geringeren Einfluss ausübten, als gemeinhin angenommen wird.
Die amerikanischen Gründerväter waren hingegen überzeugte Anhänger der Idee der Regierung durch Repräsentation. Noch mehr gilt dies für Sieyès. Wie die klassischen Forschungen von Karl Loewenstein [1990] gezeigt haben, kontrastierten die Vorstellungen der französischen verfassungsgebenden Nationalversammlung von 1789 erheblich mit denjenigen Rousseaus, dessen Ideen auf die Französische Revolution überhaupt einen viel geringeren Einfluss ausübten, als gemeinhin angenommen wird [Fetscher 1975, 258-304].
Die Väter des modernen, letztlich angelsächsischen Konstitutionalismus – auch wenn es in Europa seit dem Mittelalter, etwa in Aragonien und auch in Frankreich, noch andere Formen von Konstitutionalismus gab – träumten nicht von Volkssouveränität und Basisdemokratie, sie wollten die Menschheit vielmehr lehren: Genug mit den „Souveränen“! Jede Souveränität, auch jene des Volkes oder der „Nation“, hat sich dem Recht unterzuordnen, letztlich den wahren und unveräußerlichen Rechten des Menschen und Bürgers. Ohne ihre Respektierung kann es keine legitime Regierungsgewalt geben. Deshalb ist das Volk befugt, sich eines diese Rechte missachtenden Regimes zu entledigen.
Liberaler Konstitutionalismus – die Kombination von Locke, Montesquieu und angelsächsischer Rule of Law – ist eng verbunden mit der aus dem Mittelalter stammenden Tradition des Widerstandsrechtes.
Liberaler Konstitutionalismus – die Kombination von Locke, Montesquieu und angelsächsischer Rule of Law – ist eng verbunden mit der aus dem Mittelalter stammenden Tradition des Widerstandsrechtes [dazu Kern, 1980]. In der Tat ist Konstitutionalismus die moderne, in eine politische Institutionenethik des Friedens eingebundene Form des Widerstandsrechtes. Im Unterschied zum mittelalterlichen Widerstandsrecht ist die konstitutionalistischen Variante nicht anarchisch, sondern selbst eine verfassungsmäßig geordnete Rechtsinstitution.
Wegen seiner grundsätzlichen Ablehnung der Idee des Widerstandsrechtes ist übrigens auch Kant nur mit Einschränkungen zu den Gründervätern des politischen Ethos der Moderne zu zählen. Die – spezifisch deutsche und von Kant mitbegründete – Idee des „Rechtsstaates“ ist von der angelsächsischen, konstitutionellen Regierungsformen zugrundeliegenden Idee der „Rule of Law“ zu unterscheiden. „Rechtsstaat“, das hieß staatliche Souveränität, Regierungsgewalt, öffentliches Leben und die Beziehung zwischen Staat und Individuum nach Rechtsprinzipien zu gestalten. Nicht aber bedeutete es bereits, dass auch der Souverän – die oberste Gesetzgebungs- und Regierungsgewalt – unter dem Recht steht und durch dieses gebunden ist
Jeder moderne Verfassungsstaat ist demnach auch ein Rechtsstaat; aber nicht jeder Rechtsstaat ist notwendigerweise ein Verfassungsstaat, in der die Rule of Law gilt, in der es also keine über dem Gesetz stehende souveräne Gewalt gibt. Das ist nun noch weiter auszuführen, und zwar aufgrund einer bahnbrechenden und bis heute verfassungsrechtlich relevanten Unterscheidung, die wir keinem anderen als Sieyès verdanken: der Unterscheidung zwischen pouvoir constituant (verfassungebender Gewalt) und pouvoir constitué (verfasster oder konstituierter Gewalt).
Der Beitrag Sieyès‘: Verfassungsgebende und verfasste Gewalt
Ein Rechtsstaat kann, und so zeigt es etwa die deutsche Geschichte, durchaus auch eine monarchische Autokratie sein, in der es einen Souverän gibt, der über dem Recht steht und diesem nur insoweit „unterworfen“ ist, als er sich ihm jeweils selbst unterwirft. „Rule of Law“ heißt aber – um es zu wiederholen – letztlich Nichtexistenz eines über dem Recht stehenden Souveräns, der sozusagen im rechtsfreien Raum schalten und walten und damit, wie in den sogenannten konstitutionellen Monarchien des 18. Jahrhunderts, nach eigenem Gutdünken eine Verfassung einfach wieder abschaffen kann – genau so, wie sie auch durch das Placet des Monarchen in Kraft gesetzt worden war.
Einen solchen Souverän gibt es im liberalen Verfassungsstaat formell nur noch in der Form der verfassungsgebenden Gewalt – des pouvoir constituant – nicht mehr jedoch als konstituierte Regierungsgewalt – als pouvoir constitué. Letztere, und damit jede Regierungsgewalt, ist der Verfassung und richterlicher Kontrolle unterworfen. Die Monarchen des 19. Jahrhunderts – mochten sie sich auch „konstitutionelle“ Monarchen nennen – waren hingegen konstituierte und konstituierende Gewalt in einer einzigen Person. Der pouvoir constituant lag ihnen nicht voraus , war ihnen nicht übergeordnet, sondern sie waren selbst diese Gewalt, die über Existenz oder Nichtexistenz der Verfassung und letztlich auch über ihren Inhalt entschied.
Falls es so etwas wie unveräußerliche Menschenrechte gibt, was ja gerade die Ideengeber der Französischen Revolution behaupten, müssen diese notwendigerweise auch von der verfassungsgebenden Gewalt anerkannt werden. Sie besitzen also gleichsam naturrechtliche Geltung.
Genau diese Unterordnung jeder verfassten unter eine von ihm verschiedene verfassungsgebende Gewalt ist das entscheidende Merkmal des liberalen Verfassungsstaates.[2] Diese auch noch im heutigen Verfassungsrecht grundlegende Unterscheidung zwischen einer verfassungsgebenden Gewalt, die ungebunden ist, „alles kann“ und die Verfassung schafft, und einer verfassten, „konstituierten“ Gewalt, die durch eine geltende Verfassung und die in ihr festgelegten Rechtsinstitutionen gebundenen Gewalt, stammt wie gesagt von Sieyès. Solange die Verfassung gilt, gibt es keine Person und keine Instanz, die diese außer Kraft setzen kann oder über ihr steht. Allein die in der Verfassung selbst grundgelegten Regeln einer Verfassungsänderung oder gar vollständigen Revision durch Wahl einer neuen verfassungsgebenden Körperschaft (einer Konstituante) können – auf legale, nichtrevolutionäre Weise – den Weg zu einer neuen Verfassung ebnen (wobei dann in der Regel, aber nicht notwendigerweise, das letzte Wort das Volk hat, das über die Annahme einer neuen Verfassung entscheidet und somit, falls es in den Regeln für die Schaffung einer neuen Verfassung so vorgesehen ist, der eigentliche Souverän bzw. die eigentliche verfassungsgebende Gewalt ist).
Unveräußerliche Menschrechte und Naturrecht
Allerdings: Gemäß den Vorstelllungen von 1789 ist streng genommen nicht einmal der pouvoir constituant absolut und souverän. In materieller Hinsicht ist er dies nämlich gerade nicht. Falls es so etwas wie unveräußerliche Menschenrechte gibt, was ja gerade die Ideengeber der Französischen Revolution behaupteten, müssen diese ja notwendigerweise auch von der verfassungsgebenden Gewalt anerkannt werden. Sie besitzen also gleichsam naturrechtliche Geltung. Die verfassungsgebende Gewalt steht also nicht vor einem normativen Nichts, wie der österreichische Staatsrechtler Hans Kelsen und mit ihm der Rechtspositivismus behaupten. Eine Verfassung, die diese Rechte nicht respektierte, wäre aufgrund der Kriterien der Französischen Revolution nicht legitim.
Mit anderen Worten: Keine Souveränität, die sich als absolut schrankenlos begreift, kann in ihrer Ausübung Legitimität besitzen. Ihre Schranken sind die Grundrechte des Menschen und Bürgers. Jede souveräne Staatsgewalt hat sich als politische Gewalt dem zu unterwerfen, was jede politische Gewalt überhaupt erst rechtfertigt. Auch wenn – gemäß dem Wort von Sieyès – die konstituierende Gewalt „alles kann“, so heißt dies nur, dass sie formalrechtlich und machtpolitisch durch keine andere Institution in die Schranken gewiesen werden kann, weil sie sozusagen in einem positivrechtlichen Vakuum agiert. Das heißt aber nicht, dass diese rechtlich-institutionell „allmächtige“ Gewalt nicht in rechtsethischer Hinsicht – also in der Perspektive der politischen Moral – an gewisse Inhalte gebunden ist. Die Väter der Französischen Revolution haben das anerkannt, indem sie den Kataloge der Menschen und Bürgerrechte zur Präambel und Teil der Verfassung erklärten.
Allerdings müssen auch diese Menschen- und Bürgerrechte in irgendeiner Weise kodifiziert werden, und da herrscht oft keine Einigkeit. Das Problem der originären Rechtsschöpfung ist also nicht mit geometrischer Eindeutigkeit auflösbar. Letztlich gilt, was geschrieben steht, auch weil sonst keine Rechtssicherheit herrschen würde. Schon Thomas von Aquin vertrat die Meinung, ein Richter dürfe sein Urteil allein auf geschriebenes Recht gründen. Das ist der wahre Kern des Rechtspositivismus. Aber dieses positiv geltende Recht unterliegt immer der Möglichkeit der rechtsethischen Kritik aufgrund naturrechtlicher Grundsätze, die, auch wenn darüber keine Einigkeit besteht, dennoch als Horizont und Kriterium rechtsethischer Fundierung verbleiben. Auch diese Forderung ist ein Vermächtnis von 1789.
Durch die Rückbindung des Konstitutionalismus an die Idee der Menschenrechte gibt es demnach nicht nur illegitimes Regieren, sondern auch illegitime Verfassungs- und Rechtsordnungen.
Kurz: Der pouvoir constituant ist zwar, im politischen Sinne, eine originär rechtsschöpfende Macht – und in diesem Sinne „souverän“ und „allmächtig“ –, aber dies versteht sich eben allein hinsichtlich seiner Funktion, positives Recht zu schaffen. Durch die Anerkennung von unveräußerlichen Menschenrechten erklärt sich auch der pouvoir constituant als zu nicht allem und jedem legitimiert; er unterwirft sich also, will er seine Legitimität bewahren, naturrechtlichen Schranken. Somit kann er also nicht Recht an sich schaffen gemäß der Maxime „Recht ist, was dem Souverän gefällt“, sondern muss auch als verfassungsgebende Gewalt bereits existierendes Recht anerkennen. Zumindest muss er nach diesem Recht suchen und es so weit wie möglich – z.B. wie 1789 im Sinne einer verfassungsrechtlich verbindlichen „Erklärung der Menschen und Bürgerrechte“ – zu geltendem positiven Recht erheben, also kodifizieren, und damit auch juristisch einklagbar machen..
Durch die Rückbindung des Konstitutionalismus an die Idee der Menschenrechte gibt es demnach nicht nur illegitimes Regieren, sondern auch illegitime Verfassungs- und Rechtsordnungen und macht es unter Umständen auch Sinn, einen Staat als „Unrechtsstaat“ zu bezeichnen. All dies entspricht dem klassischen Geist des Widerstandsrechtes.[3]
Immanuel Kant: Kein liberaler Verfassungstheoretiker
Der bereits oben kurz erwähnte Immanuel Kant gilt vielen als Prototyp eines liberalen Staatstheoretikers. Doch das ist ein Missverständnis. Gewiss: Kants Rechtsphilosophie atmet liberalen Geist, nicht aber trifft dies auf seine Verfassungslehre zu, die letztlich hinter grundlegenden Eigenschaften des liberalen Konstitutionalismus – im Sinne der angelsächsischen Rule of Law – zurückbleibt und eher dem nahesteht, was man als typisch deutsches „Obrigkeitsdenken“ bezeichnet.
Denn Kant – und darin zeigt sich der Unterschied zum Geiste eines Johne Locke oder Montesquieu – lehnte jegliches Widerstandsrecht explizit ab [Über den Gemeinspruch, A 249-260; Metaphysik der Sitten B 203 ff.]. Seine Argumente sind der Souveränitätslehre von Hobbes verpflichtet, der im Recht auf Widerstand die eigentliche Quelle von Unfrieden und Bürgerkrieg erblickte, dessen Vermeidung für Hobbes das höchste politische Gut schlechthin ist. Das schlimmste Vermächtnis des Mittelalters war für Hobbes die Legitimierung des „Tyrannenmordes“ – wobei für ihn das Schlimme des Tyrannenmordes darin lag, dass einer oder einige sich dabei ein Urteil darüber anmaßten, was gerecht und ungerecht ist, eine Kompetenz, die, im Dienste des Friedens und der Vermeidung von Bürgerkrieg, allein der Souverän besitze.
Dem stimmt Kant grundsätzlich zu. Mit Hobbes war Kant, ganz ähnlich wie der anfangs erwähnte Spinoza, nur in einem Punkt uneinig: Dem Untertanen, letztlich dem Philosophen, war die „Freiheit der Feder“, die Freiheit öffentlicher Kritik zu gewähren. Die „liberale Denkungsart der Untertanen“, so Kant, ist „das einzige Palladium der Volksrechte“ [Gemeinspruch A 265]. Hobbes war der Meinung gewesen, Kritik dürfe nicht öffentlich geäußert werden, ja der friedliebende Untertan habe darauf im Interesse der Stabilität des Gemeinwesens zu verzichten und dürfe Vorbehalte allein in seinem Innern hegen, sie aber nicht über seine Lippen kommen lassen, geschweige denn öffentlich diskutieren.
Kant verkannte die Notwendigkeit rechtlich-institutioneller Herrschaftskontrolle, vielmehr vertraute er dem Gang der Geschichte, der Macht des aufgeklärten Bewusstseins, das, so war er überzeugt, sich von allein durchsetzen werde.
Der Philosoph von Königsberg hingegen vertraute der „Freiheit der Feder“ und nutzte sie auch in oft mutiger Weise. Kant verkannte jedoch die Notwendigkeit rechtlich-institutioneller Herrschaftskontrolle, vielmehr vertraute er dem Gang der Geschichte, der Macht des aufgeklärten Bewusstseins, das, so war er überzeugt, sich von allein durchsetzen werde. Auch wenn Kant für eine auf Gewaltenteilung beruhende „republikanische“ Regierungsform eintrat, so war er doch gegen eine demokratische, vielmehr für eine monarchisch-autokratische „Verfassung“, in der die Souveränität ungeteilt blieb.
Das war auch die Position eines anderen großen Aufklärers – und Mitherausgebers der „Enzyklopädie“ –, Denis Didérot, und seines „aufgeklärten Despotismus“: Man vertraute auf die Macht der Ideen der „Aufklärung“ und versuchte die Machthaber – im Falle Didérots die russische Zarin Katharina die Große – von ihnen zu überzeugen, verlangte aber nicht, die Herrschenden den Institutionen des Rechts bzw. der Herrschaft des Rechts zu unterwerfen.
Aufklärungspathos ist auch heute oft noch die Kehrseite mangelnden Realitätssinnes. Kant meinte, das Recht werde durch das „unwiderstehliche Wollen der Natur“ von selbst die „Obergewalt erhalten“ [Zum ewigen Frieden B 62]. Es war die Position eines letztlich politikfremden Philosophieprofessors. Und so sollte es in Deutschland, der „verspäteten Nation“ [Plessner 1974], noch lange bleiben. Die „liberale Denkungsart der Untertanen“ wurde durch den Souverän nach Belieben gegängelt, und trotz der liberalen Stein-Hardenbergschen Reformen in Preußen (1807-1815) erhielt schließlich im deutschen Kaiserreich nicht das Recht die Obergewalt, sondern die Macht eines nationalistischen Militarismus, der den „Rechtsstaat“ als reibungslos funktionierenden, rein formalen Mechanismus nutzte und ihn schließlich in der Zeit der Weimarer Republik – durchaus mit Unterstützung des deutschen Juristenstandes, man denke an Carl Schmitt („Der Führer schützt das Recht“) –, zum Unrechtsstaat der Nazis pervertierte.
All das kann freilich nicht Kant in die Schuhe geschoben werden – dessen liberale und rechtliche Gesinnung ist über jeden Zweifel erhaben. Wohl aber steht Kant für jene deutsche Tradition, die – im Unterschied zur angelsächsischen – die praktisch-institutionelle Notwendigkeit der rechtlichen Kontrolle politischer Macht unterschätzte, ja ausblendete. Hier waren die Franzosen den Deutschen eindeutig um einige Nasenlängen voraus![4]
Liberaler Konstitutionalismus und Demokratie: Das Ethos der Freiheit
„Liberaler Konstitutionalismus“ hieß nicht Rückkehr zum vorabsolutistischen Staat – einen solchen hatte es als „Staat“ eigentlich gar nie gegeben – sondern Transformation des modernen, souveränen Territorialstaates, der zunächst als absolut regierte und zumeist großräumige Verwaltungseinheit geboren worden war. Und zwar eine Transformation aufgrund der Wiedergewinnung und Aktivierung vorabsolutistischer republikanischer Traditionsbestände wie auch der mittelalterlichen Idee des Widerstandsrechts. Ohne die Ausbildung zentraler staatlicher Bürokratien in spätmittelalterlicher und frühneuzeitlicher Epoche – dies gilt selbst für die amerikanische Kolonialverwaltung – hätte es sicherlich so etwas wie einen „Staat“, den man verfassungsmäßig hätte bändigen können, gar nie gegeben [vgl. dazu Friedrich, 1951, 40ff.]; aber die Aufgabe, ihn rechtlicher und dann auch demokratischer Kontrolle und Abstützung zu unterwerfen, war noch zu leisten.
In seiner berühmten Abhandlung „Der alte Staat und die Revolution“ von 1856 wies Alexis de Tocqueville nach, dass zwischen dem vorrevolutionären Staat des Ancien Régime und dem modernen französischen nachnapoleonischen Staat hinsichtlich seines Rückgrats – der Staatsverwaltung oder staatlichen Bürokratie – eine bruchlose Kontinuität bestand. Dasselbe gilt für alle modernen Staaten. Auch zwischen der Verwaltung des wilhelminischen Kaisertums, der Weimarer Republik, des NS-Staates und der Bonner bzw. Berliner Bundesrepublik Deutschland besteht ungebrochene Kontinuität.
Liberaler Konstitutionalismus heißt zunächst einmal Institutionalisierung der politisch-ethischen Substanz des Widerstandsrechtes im Rahmen einer spezifisch modernen politischen Friedenskultur.
Vermittelnde Rolle spielten bei der genannten Rückbesinnung auf vorabsolutistische Traditionen aber auch Johannes Althusius’ klassisches Verständnis der menschlichen Gesellschaft als consociatio und seine Lehre über die „korporative“ Einheit von Gesellschaft und souveräner Staatsgewalt, wie auch die spanische Barockscholastik (Vitoria, Suárez). Ebenso ist der Einfluss des anglikanischen, an den Aristotelismus Thomas’ von Aquin anknüpfenden Theologen Thomas Hooker auf John Locke nicht zu unterschätzen [vgl. Rosenthal, 2008]. Locke spricht vom „judicious Hooker“ und zitiert ihn als Kronzeugen gegen den patriarchalischen Absolutismus eines Sir Robert Filmer. Und wiederum war die puritanisch-kalvinistische Bundestheologie – eine ins Politische gewandte „Ekklesiologie“ –, wo sie wirkte, überall anti-absolutistisches Ferment; dies jedoch gehört bereits zur modernen Demokratiegeschichte. Liberaler Konstitutionalismus allein ist jedoch noch nicht Demokratie.
Liberaler Konstitutionalismus, so ließe sich etwas vereinfachend sagen, heißt zunächst einmal Institutionalisierung der politisch-ethischen Substanz des Widerstandsrechtes im Rahmen jedoch einer spezifisch modernen politischen Friedenskultur, die ohne die Entstehung des neuzeitlichen Flächenstaates gar nicht möglich und in dieser Form wohl auch nicht nötig geworden wäre. Die Stichworte lauten hier „Rule of Law“, deren Rückgrat eine unabhängige Justiz bildet, wie auch „limited government“, durch das Recht effizient beschränkte Regierungsgewalt. Dadurch werden fundamentale Freiheitsrechte in positives Recht verwandelt, das von Individuen vor unabhängigen Richtern eingeklagt werden kann, wie es sich gerade in den amerikanischen Erklärungen der Freiheitsrechte zeigt.
Dadurch wird – zugunsten der individuellen Freiheit – politische Machtausübung rechtlicher Kontrolle unterworfen. Gewalten werden geteilt, so dass sie ein System gegenseitiger Kontrolle und ein Gleichgewicht bilden. „Machtstreben muss Machtstreben entgegenwirken“ [James Madison, Artikel im Federalist vom 22.11. 1787]: Misstrauen gegen menschliche Machtausübung und Sicherung der Freiheit sind die Stichworte, – also just das Gegenteil jenes „aufgeklärten Despotismus“ Didérots, der sein ganzes Vertrauen auf die (durch Philosophen) aufgeklärte absolute Macht des Herrschers richtete, oder Kants bloße „Freiheit der Feder“, um die Mächtigen zur Einsicht zu bringen und damit den Gang der Geschichte in die richtige Richtung zu lenken.
Vom liberalen Konstitutionalismus zur liberalen Demokratie
Die sich selbst überlassene Freiheit der rechtlich basierten konstitutionellen Regierungsform tendierte jedoch nicht von selbst schon dazu, Freiheit für alle zu werden. Bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts befand sich das englische Parlament weitgehend in den Händen einer aristokratischen und städtischen Oligarchie. Die französischen Liberalen der Restaurationszeit (Benjamin Constant, Adolphe Thiers u.a.) waren überzeugt, dass „Demokratie“ – allgemeines Wahlrecht – nicht taugte: Menschen ohne Bildung und Besitz könne keine politische Machtausübung anvertraut werden. Ein stark einschränkendes Zensuswahlrecht war zunächst allgemeine, nicht ohne einen gewissen Realitätssinn vorgebrachte Forderung der Liberalen – wie sie nun allmählich genannt wurden –, und schon die erste französische Revolutionsverfassung beschränkte, wie bereits erwähnt, das Wahlrecht auf eine dermaßen kleine Zahl von „aktiven Bürgern“, dass die Mehrzahl des Volkes sich nicht repräsentiert fühlte, ein Makel, den die Jakobiner dann in demagogischer Weise zur eigenen Legitimierung auszunützen wussten.
Die „Demokratisierung“ des Verfassungsstaates – diese hatte sich der amerikanische Bundesstaat von Anfang an in die Wiege gelegt – wurde zur Hauptforderung der sogenannten Radikalen des neunzehnten Jahrhunderts. Das war auch Folge des einmaligen Vorgangs der industriellen Revolution, welche nicht nur dem Bürgertum eine ganz neue Funktion zuwies, sondern auch Massen von Industriearbeitern erzeugte, diese gleichsam „nach oben schob“ und zur Einforderung politischer Repräsentation drängte.
J. S. Mill ist einer der ersten Liberalen, für die Repräsentation und allgemeines Wahlrecht selbstverständlich zusammengehörten. Der neuzeitliche, in die Tradition des repräsentativen Parlamentarismus eingebundene Verfassungsstaat musste, sollte er seine Legitimität nicht verlieren, zum demokratischen Verfassungsstaat werden.
Die Erfahrung, durch John Stuart Mill klassisch formuliert, lautete: Ein Parlament, in dem die „arbeitende Klasse“ nicht direkt repräsentiert ist, wird auch keine Frage „mit den Augen eines arbeitenden Mannes“ behandeln [J. S. Mill, Considerations on Representative Government, III, 209]. Interessenwahrnehmung setzt unmittelbare Repräsentation dieser Interessen, und das heißt: allgemeines Wahlrecht voraus. J. S. Mill ist einer der ersten Liberalen, für die Repräsentation und allgemeines Wahlrecht selbstverständlich zusammengehörten. Der neuzeitliche, in die Tradition des repräsentativen Parlamentarismus eingebundene Verfassungsstaat musste, sollte er seine Legitimität nicht verlieren, zum demokratischen Verfassungsstaat werden. Dabei wurde allerdings das Prinzip „Repräsentation“ selbst uminterpretiert: Während es in der englischen Tradition als „virtuelle“ Vertretung der Interessen aller durch einige wenige verstanden wurde, begann man nun – und dies schon im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg, gegen das britische Mutterland gerichtet – die effektive Vertretung von Interessen zu fordern. Doch das ist eine andere Geschichte.
Die Herrschaft des Rechts, Parlamentarismus und Repräsentationsprinzip allein machen jedenfalls noch keine Demokratie im heutigen Sinne aus. Doch – und das ist der entscheidend wichtige Punkt, der gegen die Jakobiner jeder Epoche immer wieder betont werden muss, – kann es keine freiheitliche, liberale Demokratie geben, die nicht gleichzeitig von der Herrschaft des Rechts, von Parlamentarismus und vom Prinzip der Repräsentation geprägt ist – also von Körperschaften, in denen einige wenige legitimerweise verbindliche Entscheidungen für die Gesamtheit der Bürger treffen. Und zwar in einer rechtlich geregelten und damit auch klar beschränkten Weise. Auch der demokratische Verfassungsstaat muss von der Herrschaft des Rechts und dem, was die Angelsachsen „limited government“ nennen, geprägt sein, will er nicht zu einer Tyrannei der Mehrheit werden.
Liberale Demokratie: Nicht simple „Herrschaft der Mehrheit“
Wer dies ablehnt zugunsten einer, wie man es nennt, identitären Konzeption von Demokratie, die von der Fiktion der Identität der Regierenden und der Regierten ausgeht, eine Homogenität der Interessen reklamiert und den Partikularinteressen den Kampf ansagt, ja selbst wer direkte Demokratie einseitig gegen das Prinzip der parlamentarischen Repräsentation ausspielt und darin einen unvereinbaren Gegensatz sieht, der steht in der Tradition Rousseaus und der Jakobiner, die jedoch als solche nicht den Geist der Französischen Revolution schlechthin repräsentieren, sondern nur einer ihrer Durchgangsphasen, und zwar jener, der schließlich nicht der Erfolg gehören sollte.
Ebenso wenig sind Mehrheitswahlrecht oder „Herrschaft der Mehrheit“ allein schon Demokratie in dem Sinne, wie wir sie heute in der westlichen Welt verstehen. Kritiker der Demokratie, etwa aus dem libertär-anarchokapitalistischen und konservativen Lager (wie Hans-Hermann Hoppe oder Erik von Kuehnelt-Leddihn), reduzieren Demokratie in der Regel – polemisch, aber unsachgemäß – auf ein bloßes „Mehrheitswahlrecht“ bzw. auf die „Herrschaft der Mehrheit“. Das ist eine Karikatur und sowohl sachlich wie auch historisch falsch. „Liberale Demokratie“ ist der liberale Verfassungsstaat, wie er der angelsächsischen Tradition entspringt – also Rule of Law, Gewaltenteilung, Unabhängigkeit der Justiz, parlamentarische Repräsentation usw. –, aber in seiner demokratisierten Form mit allgemeinen Wahlrecht. Die Mehrheitsregel spielt eine entscheidende prozedurale Rolle, bestimmt aber nicht in letzter Instanz, was politisch und rechtlich möglich ist [dazu auch Dahl, 1991].
Mehrheitsentscheidungen unterliegen in einer liberalen Demokratie der Herrschaft des Rechts, sie müssen in jedem Fall verfassungsmäßig sein und die Menschen- und Bürgerrechte respektieren. Wichtig ist deshalb auch immer der Schutz der Minderheiten und ihrer verfassungsmäßigen Rechte. Nicht eine jakobinische „Herrschaft der Mehrheit“ ist das bleibende Vermächtnis der Französischen Revolution, sondern eher die liberale, verfassungsstaatliche Komponente, auch wenn sie aus der doch reichlich verworrenen Geschichte des revolutionären Geschehens gleichsam herausgeschält werden muss.
Anmerkungen
[1] In einem Brief vom 26. Juli 1767 – elf Jahre vor seinem Tod – an den älteren Marquis de Mirabeau, den Physiokraten, gestand Rousseau, dass seine Vorstellungen, die klassische Idee der Herrschaft des Gesetzes über den Menschen zu verwirklichen, in der Tat der „Quadratur des Kreises“ glichen und kaum durchführbar seien. Deshalb sei wohl doch Hobbes mit seiner Lösung recht zu geben, den Menschen im Sinne eines despotisme arbitraire über das Gesetz zu stellen. Nur müsse nun – eine erneute Quadratur des Kreises? – für diesen Despotismus eine Sukzessionsregel gefunden werden, die weder auf Vererbung noch auf Wahl beruhe, eine Regel „par laquelle on s’assure, autant qu’il est possible, de n’avoir ni des Tibère, ni des Néron“. Nie werde er, Rousseau, jedoch wohl das Unglück haben, sich mit dieser folle idée beschäftigen zu müssen [Text in Mayer-Tasch 1976, 127-130].
[2] Die direkte Demokratie Schweizer Art ist hier eine historisch wohl einmalige Ausnahme, nämlich eine Kombination der – die Idee der Repräsentation ablehnenden – Ideen Rousseaus mit jenen des angelsächsischen Parlamentarismus US-amerikanischer Art (Zweikammersystem). Denn in der schweizerischen direkten Demokratie kann der „Souverän“ – das Volk – theoretisch jederzeit verfassungsgebend aktiv werden, nämlich durch sein Recht, über von ihm selbst eingereichte Verfassungsinitiativen letztlich verbindlich abzustimmen; zudem kann das Volk Entscheidungen des Parlamentes, also der „konstituierten Gewalt“, – die im ordentlichen Gesetzgebungsverfahren dieses Volk repräsentiert –, durch ein Referendum vor eine Volksabstimmung bringen und damit unmittelbar gesetzgebend tätig werden. Allerdings gibt es auch hier Hürden und Bremsen etwa das sogenannte Ständemehr: Für Verfassungsänderungen genügt nicht die einfache Stimmenmehrheit aller „Stimmbürger“, sondern nötig ist auch die Mehrheit der Stände (Kantone). Dabei sind die Stimmen bevölkerungsarmer Kantone genau gleich gewichtet wie jene der bevölkerungsreichen: Jeder hat eine Stimme.
[3] Die amerikanische Verfassung anerkannte von Anfang an – allerdings erst später in ihrem neunten Zusatzartikel von 1791 auch explizit –, dass auch die nicht in der Verfassung genannten Rechte dem Volk verblieben sind. Recht ist also nicht identisch mit positivem Recht. Das war auch der Grund, weshalb viele Verfassungsväter grundsätzlich dagegen waren, einen Katalog von Menschenrechten in die Verfassung aufzunehmen: Sie fürchteten, dass dadurch die Meinung entstehen könnte, dass Rechte, die nicht explizit in der Verfassung stünden, wohl aber in einzelnen Staaten als solche anerkannt waren, dann auf Bundesebene nicht mehr als solche gelten würden.
[4] Natürlich haben Juristen oder Richter selbst keine politische Macht, um ihre Entscheidungen durchzusetzen; als Teil eines konstitutionellen Regierungssystems, das auf Gewaltenteilung und auf „Checks and balances“ beruht und eingebunden ist in prozedurale Regeln der (demokratischen) Regierungsbildung, deren Beachtung selbst wiederum mit Hilfe des staatlichen Gewaltmonopols erzwungen werden kann, besitzen richterliche Entscheidungen aber genau jenes Durchsetzungsvermögen, das für eine effektive „Herrschaft des Rechts“ nötig ist.
Bemerkung: In einer ersten Fassung dieses Beitrags wurde als Verfasser der Virginia Declaration of Rights fälschlicherweise Thomas Jefferson, der Verfasser der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, genannt. In Wirklichkeit war der Verfasser der Virginia Declaration of Rights George Mason, mit wichtigen Korrekturen von James Madison. George Mason war auch der Verfasser der späteren Bill of Rights, der ersten zehn Zusatzartikel der amerikanischen Verfassung.
Zitierte Literatur:
Bagehot, W. (1971), Die englische Verfassung, Neuwied und Berlin (The English Constitution [1867], London 1955).
Beauté, Jean (1975), Un grand juriste Anglais: Sir Edward Coke 1552-1634. Ses idées politiques et constitutionnelles, ou aux origines de la démocratie occidentale moderne, Paris.
Blackstone, Sir William (1890), Commentaries on the Laws of England (4 vol. 1765, 66, 68 e 69), ed. William G. Hammond, Bancroft-Whitney, San Francisco.
Bobbio, Norberto (1990), L‘età dei diritti, Torino.
Boutmy, Émile (1964), La déclaration des droits de l‘homme et M. Jellinek, Annales des sciences politiques, XVII (1902), 415-443 (Neudruck in Boutmy, Émile, Etudes Politiques, Paris 1907, 119 ff.; deutsch in: Schnur, Roman (Hrsg.) (1964), 8-112, mit einer Replik von Georg Jellinek).
Dahl, Robert A. (1991), Democracy and Its Critics, Yale.
Fetscher, Iring (1975), Rousseaus politische Philosophie. Zur Geschichte des demokratischen Freiheitsbegriffs, Suhrkamp, Frankfurt/M. 3. Aufl.
Friedrich, C. J. (1953), Der Verfassungsstaat der Neuzeit, Berlin (orig, Constitutional Government and Democracy, 3. ed. Boston 1951).
Hale, Chief Justice Sir Matthew (1956-64), Reflections by the Lord Chief Justice Hale on Mr. Hobbes his Dialogue of the Law (in Holdsworth, William S., History of English Law, 13 vol., 7. ed. London, vol. V, Appendix III, 500-513).
Hamilton, Madison, Jay (1993), Die Federalist Papers, übersetzt, eingeleitet und mit Anmerkungen versehen von B. Zehnpfennig, Darmstadt.
Jellinek, Georg (1964), Die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte, 3. ed. München 1919; in: Schnur, Roman (Hrsg.) (1964).
Kern, Fritz (1980), Gottesgnadentum und Widerstandsrecht im früheren Mittelalter. Zur Entwicklungsgeschichte der Monarchie, 7.ed., Neudruck der 2. Aufl. 1954 (hrsg. von Rudolf Buchner), Darmstadt.
Kluxen, K. (1983), Geschichte und Problematik des Parlamentarismus, Frankfurt a. M.
Kriele, Martin (1990), Einführung in die Staatslehre. Die geschichtlichen Legitimitätsgrundlagen des demokratischen Verfassungsstaates, 4. Aufl. Opladen.
Loewenstein K. (1990), Volk und Parlament nach der Staatstheorie der französischen Nationalversammlung von 1789, 2. Nachdruck der Ausgabe München 1922, Aalen.
Mayer-Tasch, Peter C. (1976), Hobbes und Rousseau, Aalen.
Mill, J. S. (1972), Utilitarianism, On Liberty, and Considerations on Representative Government, hrsg. von H. B. Acton, London.
Montesquieu (1973), De l’Esprit des Lois, hrsg. von R. Derathé, Paris.
Palmer, R. R. (1959), The Age of Democratic Revolution, Vol. I: The Challenge, Princeton, New Jersey.
Plessner, Helmut. (1974), Die verspätete Nation, Frankfurt a. M.
Rhonheimer, Martin (2000), „Autoritas non veritas facit legem“: Thomas Hobbes, Carl Schmitt und die Idee des Verfassungsstaates. In: Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie / Archives for Philosophy of Law and Social Philosophy, Vol. 86, No. 4 (2000), 484-498.
Rhonheimer, Martin (2012), Christentum und säkularer Staat. Geschichte – Gegenwart – Zukunft. (Mit einem Vorwort von E.-W. Böckenförde), Freiburg i. Br.
Rosenthal, Alexander S. (2008), Crown Under Law: Richard Hooker, John Locke, and the Ascent of Modern Constitutionalism, Lanham.
Schnur, Roman (Hrsg.) (1964), Zur Geschichte der Erklärung der Menschenrechte, Darmstadt 1964.
Siéyès, E. J. (1975), Politische Schriften 1788-1790 mit Glossar und kritischer Sieyes-Bibliographie (übersetzt und hrsg. von E. Schmitt und R. Reichardt), Darmstadt und Neuwied.
Teilen auf